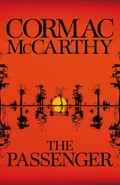ichEs ist die Tiefe der Dunkelheit, die Bobby Western erschreckt, den verfolgten Mann im Herzen von Cormac McCarthys außergewöhnlichem neuen Roman. Western arbeitet als Bergungstaucher im Golf von Mexiko und kümmert sich um gesunkene Lastkähne und beschädigte Bohrinseln. Er wirbelt im lehmfarbenen Wasser Wolken auf und dringt mit jedem gewichtigen Schritt weiter ins Unbekannte vor. Seine Kollegen sind gleichgültig, aber die Erfahrung hat ihn gelehrt, vorsichtig zu sein. Er fragt: „Sind Sie da unten jemals auf etwas gestoßen, von dem Sie nicht wussten, was es war?“
Volle 16 Jahre nach dem Pulitzer-Preisträger The Road veröffentlicht, ist The Passenger selbst wie ein untergetauchtes Schiff; eine wunderschöne Ruine in Form eines hartgesottenen Noir-Thrillers. McCarthys Generationensaga umfasst alles von der Atombombe über die Ermordung Kennedys bis hin zu den Prinzipien der Quantenmechanik. Es ist abwechselnd muskulös und rührselig, immersiv und nachsichtig. Jeder Roman, sagte Iris Murdoch, ist das Wrack einer perfekten Idee. Dieser ist enorm. Es hat verschlossene Türen und blinde Kurven. Es enthält Skelette und vergrabenes Gold.
Etwa 40 Fuß unter der Oberfläche erkundet Western einen abgestürzten Charterjet. Im Rumpf bahnt er sich seinen Weg an den herumtreibenden Trümmern und den glasäugigen Opfern vorbei, die immer noch in ihren Sitzen angeschnallt sind. Das Flugzeug beförderte acht Passagiere, aber einer scheint zu fehlen, und die anschließende Untersuchung deutet auf eine Vertuschung durch die Regierung hin. Abgesehen davon, dass dies ein Ablenkungsmanöver sein kann; Wir sind immer noch in den Untiefen des Buches. Wir stellen fest, dass die Probleme von Western insgesamt näher an der Heimat liegen.
McCarthy begann Mitte der 1980er Jahre mit der Arbeit an The Passenger, noch vor seiner Karriere machenden Border-Trilogie; es Stück für Stück aufzubauen und es im Laufe der Jahre wieder zu besuchen. Kein Wunder also, dass sich diese Familientragödie filetiert anfühlt, Teil eines größeren Ganzen und mit so vielen losen Enden hinterherläuft, dass eine selbsternannte „Coda“ – ein zweiter Roman, Stella Maris, der im November veröffentlicht wurde – erforderlich ist, um die Geschichte zu vervollständigen. Dies ist also ein Buch ohne Leitplanken, eine Einladung zum Verirren. Wir stoßen ständig auf dunkle Objekte und fragen uns, was sie bedeuten.
Angeblich sieht die Erzählung, wie der Western um das New Orleans der frühen 80er Jahre flippt, mit den Einheimischen tanzt und versucht, seine Feinde zu überflügeln. Aber es wirft auch Jahrzehnte zurück und baut seine quasi inzestuöse Bindung zu seiner selbstmörderischen Schwester Alicia ab. Auf dem Weg führt es uns in ihre alptraumhaften Halluzinationen ein: „das Thalidomide Kid und die alte Dame mit der Roadkill-Stola und Bathless Grogan and the Dwarves and the Minstrel Show“. Alicia vergleicht diese Dämonen mit einer Truppe mickriger Entertainer. Sie materialisieren sich an ihrem Bett, wenn sie ihre Medikamente auslässt.
Auf prosaischer Ebene feuert McCarthy – jetzt 89 – weiterhin aus allen Rohren. Sein Schreiben ist kraftvoll, berauschend und gleicht üppige Dialoge mit sparsamen, lebendigen Beschreibungen aus. Das Freudenfeuer, das sich im Seewind lehnt; die brennenden Gestrüppstücke, die den Strand hinaufhumpeln. Als Geschichtenerzähler vermute ich jedoch, dass er absichtlich herunterfährt und abschließt. Dieser Roman spielt sich wie ein großer Sterbefall ab.
Wie wir erfahren, sind Western und Alicia Kinder der Bombe. Ihr Vater war ein bekannter Kernphysiker, der half, das Atom zu spalten, was zur Zerstörung von Hiroshima und Nagasaki führte. Western hat in seiner Jugend selbst Physik studiert. Er lernte Protonen und Quarks, Leptonen und die Stringtheorie kennen, gab aber seine Berufung für ein Leben als Arbeiterdrift auf. Die Quantenmechanik, so glaubt er, kann uns nur so weit bringen. „Ich weiß nicht, ob es wirklich etwas erklärt“, sagt er. „Man kann das Unbekannte nicht illustrieren.“
McCarthys Interesse an Physik wurde durch seine Zeit als Treuhänder am Santa Fe Institute, einem gemeinnützigen Forschungszentrum, geweckt. Seit 2014 hat er sich weitgehend mit den Gelehrten verschanzt und die Grenzen der Wissenschaft – und vermutlich auch der Sprache – ausgelotet, nur um zu dem Schluss zu kommen, dass kein System fehlerfrei ist. High-Concept-Grundstücke nehmen Wasser auf; maschinell bearbeitete Erzählungen brechen zusammen. Und so ist es auch bei The Passenger, das als existenzieller Verfolgungsthriller in der Form von No Country for Old Men beginnt, bevor es in sich zusammenbricht. Western könnte seine Verfolger überflügeln, aber er kann seiner eigenen Geschichte nicht entkommen. Also geht er allein in die Wüste, um die in der Ferne brennenden Ölraffinerien zu beobachten und die teppichfarbenen Vipern zu beobachten, die sich im Gras zu seinen Füßen winden. „Der Abgrund der Vergangenheit, in den die Welt stürzt“, denkt er. „Alles verschwindet, als wäre es nie gewesen.“
Was für ein herrliches Sonnenuntergangslied von einem Roman das ist. Es ist reich und es ist seltsam, sprunghaft und melancholisch. McCarthy begann als Preisträger des amerikanischen Schicksals, indem er seine hartnäckigen Berichte über räuberische weiße Männer weiterspinnte. Er beendet seine Reise vielleicht als der gelbsüchtige Bestattungsunternehmer der Ära. Kommen freundliche Bomben. Komm aufsteigende Ozeane. Die alte Welt liegt im Sterben und wahrscheinlich nicht vor der Zeit, und The Passenger schleicht sich herein, um alle Lichter auszuschalten.