Hier zeigt und beschreibt die Fotostiftung Schweiz Highlights aus ihrer Sammlung
Ein letzter Maskenball
Henriette Grindat: Aus der Serie «Essais surréalistes», 1944 – 1949.
Besonders verstörend sind Masken, wenn nichts dahinter ist. Edgar Allan Poes Erzählung «Die Maske des roten Tods» berichtet davon: An einem Maskenball taucht ein Gast auf, der so furchterregend ist, dass ihn der Gastgeber um jeden Preis entlarven will. Doch hinter der Maske kommt nichts zum Vorschein – denn der Gast ist der Tod.
Auch Henriette Grindats (1923–1986) Bild ist weit mehr als eine im Vorübergehen erhaschte Karnevalsimpression. Es gehört zu den «Essais surréalistes», mit denen die junge Westschweizer Fotografin unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in Paris Aufsehen erregte: In der Tradition der surrealistischen Fotografie interessierte sich Grindat für eine fragmentierte Körperlichkeit, Identitätsverlust und für all jene paradoxen Risse im Alltag, die den Blick ins Unbewusste freigeben. Die Maske als Symbol des Verhüllens einer tiefer liegenden Wahrheit – oder einer existenziellen Leere – spielte dabei eine wichtige Rolle.
André Breton, Raoul Ubac und andere Protagonisten aus dem Umfeld des Surrealismus waren von Grindats Fotografien begeistert, Man Ray ermutigte die junge Künstlerin zu ihrer ersten Ausstellung in der legendären Buchhandlung und Galerie «La Hune». Grindat sei eine «Träumerin der Materie», schrieb der Kritiker Charles-Henri Favrod treffend: «Sie flüchtete sich in die Exaktheit, sie vagabundierte nach Fahrplan – Schlüssel und Kompass zur Traumwelt. Ihr surrealistischer Scharfblick drängte sie gleichermassen zum Instinkt und zum Kalkül, zur Wut und zur Prüfung, zum Absurden und zur Geometrie, in einer Art Dialektik der Kontrolle und des Überströmens, der Trunkenheit, der Begeisterung.»
Ab den fünfziger Jahren arbeitete Grindat mit Schriftstellern wie Albert Camus, René Char oder Francis Ponge zusammen, später machte sie das Unterwegssein zur Methode, auch um die eigenen Abgründe zu überwinden. 1986 schliesslich brach sie zu ihrer letzten Reise auf – freiwillig. Die Vielschichtigkeit ihres Werks bleibt weiterhin zu entdecken.
Winterlandschaft mit Eisläufern

Gotthard Schuh: Schlittschuhweiher, 1936.
Gotthard Schuh (1897–1969), bekannt als einer der grossen Reporter der Schweiz, haderte immer wieder mit der Schnelllebigkeit des Fotojournalismus. Selbst in den Arbeiten für die «Zürcher Illustrierte», dank der er sich in den 1930er Jahren als Bildberichterstatter etablierte, drückt sein Hang zum Malerischen und zur zeitlosen Poesie durch. Aber auch später weist sein Schaffen viele Züge auf, die mehr ins Reich der Imagination und des Unbewussten gehören als in die Welt der realen Ereignisse. Schuhs Herkunft aus der Malerei erkennt man insbesondere bei Bildern von Frauen und Paaren, aber ebenso bei seinen zauberhaften, seltsam entrückten Landschaftsaufnahmen.
Sie vermitteln eine Art Fernweh, ein Verlangen nach Schönheit und Sinnlichkeit, eine tiefe Sehnsucht nach Wärme – Utopien im wahrsten Sinn des Wortes. «Jeder bildet nur das ab, was er sieht, und jeder sieht nur das, was seinem Wesen entspricht», notierte der Fotograf. Besonders in seinen stillen, lyrischen Arbeiten versuchte er, einer inneren Stimmung Ausdruck zu verleihen. Und häufig hatte er die Bilder schon im Kopf, wenn er sich auf die Pirsch machte. So beschäftigte er sich zu verschiedenen Zeiten mit denselben Motiven: «Die Landschaft, die schon früh mein Lebensgefühl mitgeprägt hat, war die Landschaft am Saume unserer Flussläufe. Alle später mir vertrauten Landschaften waren verwandt mit diesen Auenwäldern.
Auch sie waren immer wieder Flusssäume, Randzonen kleiner Seen oder welliges, halb urbanisiertes Gelände.» Der Schlittschuhweiher, den Gotthard Schuh 1936 im Kanton Bern fotografierte, gehört zweifellos zur Kategorie der seelenwärmenden Traumlandschaften, die der Fotograf immer wieder suchte – in der Art, wie er sie darstellte, klingen Brueghels Winterszenen mit Eisläufern nach.
Gesichter und Geschichten

Barbara Brändli: Aus der Serie «La brega diaria» (Der tägliche Kampf), 1978 – 1995
Barbara Brändli (1932–2011), Pfarrerstochter aus dem thurgauischen Basadingen, wollte eigentlich Balletttänzerin werden. Diesen Traum gab sie jedoch auf, als sie ihrem Mann, einem venezolanischen Architekten, nach Caracas folgte. Sie begann zu fotografieren, veröffentlichte bald erste Reportagen und profilierte sich später mit Buchprojekten – etwa über die brodelnde Hauptstadt.
Ihre Liebe aber galt der indigenen Bevölkerung. Schon 1962 unternahm sie eine abenteuerliche Expedition zum Oberlauf des Orinoko und begann als eine der Ersten, das Leben der Yanomami zu dokumentieren – ein Akt des Widerstands gegen die Auslöschung der Ethnie. Ein zweites Langzeitprojekt widmete sie den Anden: Ein Teil der Einheimischen hatte sich in das karge Bergland, den Páramo, zurückgezogen, als die spanischen Eroberer im 16. Jahrhundert immer weiter vorgerückt waren.
In dieser Zone zwischen 2000 und 3500 Metern über Meer lernte Brändli eine fast verschüttete Kultur kennen, die sich in einer reichen mündlichen Überlieferung spiegelte – und in Vorstellungen, in denen sich magisches Denken und christliche Sagenwelt überlagerten. Brändli hielt ihre Geschichten auf 100 Stunden Tonband fest und machte Aufnahmen wie diese: Während die Fotografin von der Frau fixiert wird, scheint der Mann in eine verlorene Vergangenheit zu blicken – oder in eine ungewisse Zukunft.
Wladimir, der Gartenzwerg

Niels Ackermann: Aus der Serie «Looking for Lenin», Kiew, 20. Juni 2016.
Von unten sieht die Weltgeschichte anders aus: Wladimir Iljitsch Lenins Kopf war wohl Teil einer überdimensionierten Figur, die den zentralen Platz einer Stadt oder eines Dorfes überblickte. Auf der Fotografie von Niels Ackermann (* 1987) hingegen darf er allenfalls den Kindern beim Ballspiel zuschauen. Einer der mächtigsten Männer des 20. Jahrhunderts erscheint als eine Art Gartenzwerg hinter dem Haus einer Frau, die sich freiwillig der ukrainischen Armee anschloss, um gegen die von Russland unterstützten Separatisten zu kämpfen.
Das in Kiew aufgenommene Fragment stammt von einem der rund 5500 Lenin-Denkmäler, die in der Ukraine während Jahrzehnten den öffentlichen Raum prägten. Als sich das Land 1991 von der Sowjetunion abspaltete, wurden sie vielerorts gestürzt und demontiert, 2015 schliesslich offiziell verboten. Dennoch blieben zahlreiche Skulpturen im Verborgenen erhalten – umgestaltet, angemalt, malträtiert und geköpft, manchmal aber auch nostalgisch verehrt. In der Ukraine fand die Vergangenheitsbewältigung kreative Wege.
2015 machte sich Ackermann zusammen mit dem französischen Journalisten Sébastien Gobert auf, Lenins Überreste aufzuspüren: in Vorgärten und Hinterhöfen, bei Altmetallhändlern oder Künstlern, die sie für Kunstprojekte verwendeten. Ihre als Buch publizierte Serie «Looking for Lenin» ist eine nüchterne und überraschende Bestandsaufnahme. Die Bilder illustrieren den Zerfall eines von oben indoktrinierten Geschichtsbilds und stellen zugleich die Frage, wie das Vakuum gefüllt werden kann – ein Lehrstück über den vergeblichen Versuch, die Geschichte zu entsorgen.
Milch und Brot

Paul Senn, Mittagessen in der Bergschule, Achseten bei Adelboden, 1935.
Zu Beginn des Winters 1935 reiste Paul Senn (1901–1953) in den abgeschiedenen Weiler Achseten bei Adelboden, um über den Alltag einer kleinen Dorfschule zu berichten. Senn, einer der ersten professionellen Reporter der Schweiz, engagierte sich gerne für Menschen am Rand der Gesellschaft. Sein Bericht aus dem Berner Oberland war Teil einer Kampagne: Durch Spenden sollte dem Schulhaus die Anschaffung des ersten Radioapparats im Dorf ermöglicht werden.
«Jeder kleine Beitrag an die eben eingeleitete Radio-Berghilfs-Aktion trägt zur Erziehung der jungen Menschen in diesen abgelegenen Gegenden bei, denn ihr Blick wird durch den Schulfunk geweitet, ihr Wissen vergrössert, ihr Ahnen um die Welt realer», konnte man in der «Schweizer Illustrierten Radio-Zeitung» lesen. Unter den Bildern, die Paul Senn ablieferte, sticht eine Fotografie heraus: Sie zeigt einen Jungen, der wie alle anderen die Mittagspause im Schulzimmer verbringt, weil der Weg nach Hause viel zu lang und beschwerlich wäre. «Die Schule schenkt ihnen heisse Milch aus, und aus ihren Tornistern kramen sie ein Stück Butterbrot.»
Senn publizierte diese Momentaufnahme später in unterschiedlichen Zusammenhängen – der gelernte Grafiker spürte wohl ihre ikonische Kraft. Vorder- und Hintergrund bleiben unscharf, die ganze Aufmerksamkeit liegt auf dem Jungen. Das abgewetzte «Tschöpli», die von der Feldarbeit gezeichneten Hände, die Konzentration auf den Moment des Trinkens, die sich in den Falten auf der Stirn spiegelt – zeichenhaft erzählt das Bild von der sozialen Situation und zugleich vom Wohlbehagen des Knaben, der am liebsten ganz in sein Schlaraffenland eintauchen möchte.
Es mag etwas weit hergeholt sein, in der Tasse die Sonne und im Brot die Mondsichel zu sehen – so wurde das Bild schon gedeutet –, doch die formale Prägnanz korrespondiert perfekt mit dem Inhalt und der Reduktion aufs Wesentliche: Milch und Brot. Die Welt des Schulfunks bleibt eine ferne Ahnung.
Nichts zu verbergen
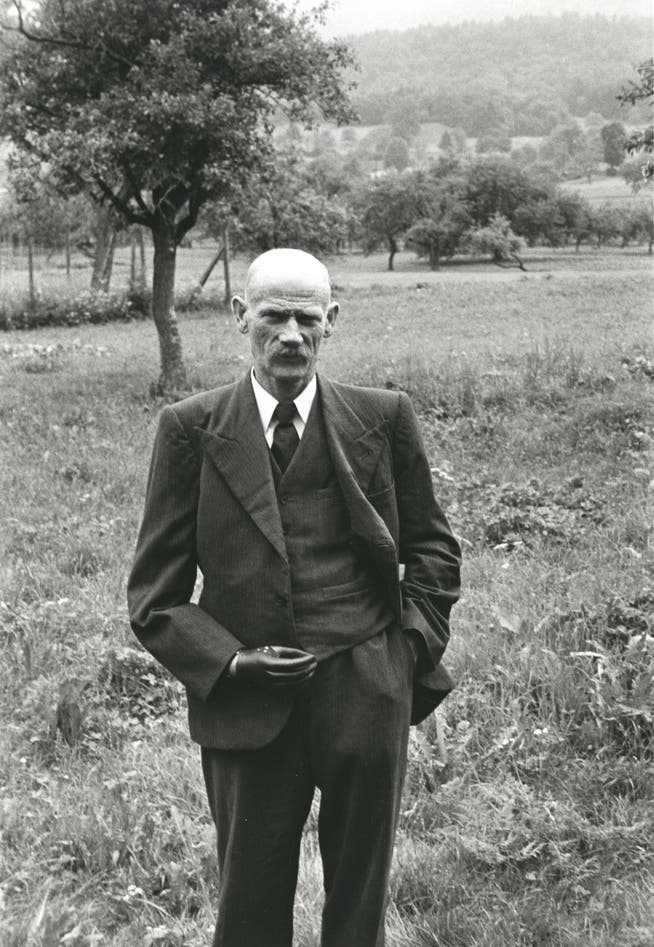
Georg Vogt: Metzger und Landwirt Adelbert Eggenschwiler-Meister (1887–1969).
Als Hitler am 10. Mai 1940 mit einer Blitzoffensive tief in den Westen vorrückt, wächst die Angst in der Schweiz: Viele Menschen, die in grenznahen Gebieten wohnen, flüchten überstürzt ins Landesinnere. Mit Personenkontrollen versuchen die Behörden, die Übersicht zu behalten, doch sie haben Mühe, die Identität der Flüchtenden zu überprüfen. Aus diesem Grund fordert das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement die Kantone auf, allen Einwohnerinnen und Einwohnern über 15 Jahre unverzüglich Identitätskarten mit Fotografien auszustellen.
Bei der Herstellung der offiziellen Bilder kommen auch Amateure zum Zug – unter ihnen der 26-jährige dienstuntaugliche Maschinenschlosser Georg Vogt (1914–1999): Er ist der Einzige, der im solothurnischen Aedermannsdorf eine Kleinbildkamera besitzt. Schon im Juni 1940 fotografiert er rund 450 Personen in drei Gemeinden des Bezirks Thal. Er porträtiert sie am liebsten im Freien und meidet direktes Sonnenlicht, wie er es in einem Lehrbuch gelesen hat. Und er sucht natürliche Situationen: Häufig nimmt er die Personen in ihren Gärten oder auf ihren Obstwiesen auf, aus leicht erhöhter Position und respektvoller Distanz.
Der 53-jährige Metzger und Landwirt Adelbert Eggenschwiler-Meister wirkt recht entspannt, obschon es ein feierlicher und ernster Moment sein muss, für den amtlichen Ausweis zu posieren. Er trägt seinen besten Anzug und rückt seine Handprothese unübersehbar in den Vordergrund; ein «wahres» Bild soll nichts verbergen. Leicht überbelichtet, fehlt dem Gesicht die feine, schön abgestufte Zeichnung – doch gerade dadurch schreibt sich die Notlage der Zeit in die Aufnahme ein. Das Porträt berührt auch deshalb, weil der Fotograf so viel mehr zeigen möchte als den eng beschnittenen Kopf, der, auf ein Stück Papier geklebt, die Identität des Mannes belegen soll.
Der Zauber nach der Show

Jutta Colberg, Circus Knie, 1953.
In den 1950er Jahren widmet sich eine Reihe bedeutender Fotografen und Filmer der Welt der Schaustellerinnen und Clowns: 1952 publiziert Robert Frank eine Fotoserie zum Thema Zirkus, 1954 kommt Fellinis «La Strada» in die Kinos, parallel dazu wird in mehreren Bildbänden das ungebundene Bohème-Leben der Artistinnen und Artisten sinnlich gefeiert. Dabei geht es vor allem um den Blick hinter die Kulissen, wo man eine Gegenwelt zur ideologisch festgefahrenen, in Konventionen erstarrten Gesellschaft findet. Allerdings geraten Clowns und Tramps schnell in Verdacht, auf der falschen Seite zu stehen, denn in der Zeit des Kalten Kriegs stellen diese Aussenseiter auch die bürgerliche Ordnung infrage. Charlie Chaplin wird 1952 als Kommunist diffamiert und aus den USA ausgewiesen.
Im folgenden Jahr fotografiert Christian Staub (1918–2004) die Artistin Jutta Colberg im Zirkus Knie, dessen Vorstellung Chaplin als Zuschauer im Schweizer Exil erlebt. Staub zeigt Colberg nicht bei ihrem Auftritt in der Manege, sondern in einem ruhigen Moment danach. Dem lauten Glamour der Vorstellung stellt er diese intime und berührende Szene gegenüber: In einer schlichten Metallschüssel sitzend, spült sie sich den Goldglitter vom Körper. Es ist, als ob darunter die wahre Person zum Vorschein käme – eine verletzliche und in sich gekehrte junge Frau.
Dabei verrät ihre anmutige Geste und Haltung, dass sie zu posieren und gemeinsam mit dem Fotografen eine Badeszene zu gestalten versteht, die sich in eine kunsthistorische Tradition einfügt. Obschon grelles Blitzlicht zum Einsatz kommt, tritt die Artistin sanft und zauberhaft aus der Dunkelheit hervor. In Staubs Bildessay «Circus», 1955 zusammen mit Zeichnungen der Künstlerin Hanny Fries veröffentlicht, ist diese Badende Teil der grossen Zirkusfamilie, die dem Publikum einen kurzen Ausbruch aus der Prüderie und Enge des damaligen Alltags ermöglicht.
Schönheitsfleck

Laurence Kubski, Sommerkomposition, 2019.
Warum hat die Fotografin Laurence Kubski (geb. 1986) dieses kleine Tierchen nicht von der zarten Lotusblüte entfernt? – Insekten spielen in der chinesischen Kultur eine wichtige Rolle. Früher beobachtete man ihr Verhalten, um den Zeitpunkt von Aussaat oder Ernte zu bestimmen; Maler und Dichter verewigten sie gerne in ihren Werken. Vor allem Grillen galten als Glücksbringer und Hoffnungsträger: Einerseits schätzte man ihren individuellen «Gesang», weshalb man sie als Haustiere hielt, anderseits wurden einige angriffslustige Arten in Miniarenen zum Kampf gegeneinander angestachelt. Solche jahrhundertealten Traditionen waren zwar während der Kulturrevolution verboten, seit einiger Zeit sind sie jedoch wieder zu einem beliebten Zeitvertreib geworden.
Für ihre Arbeit «Crickets» hat sich Laurence Kubski in China auf die Suche nach den Grillen gemacht – und dabei eine blühende Szene gefunden. Ihr fotografischer Essay berichtet von der Jagd nach den besten und stärksten Exemplaren, vom Handel mit kleinen Holzkäfigen sowie von Menschen, die sich von diesen Tieren verzaubern lassen. Kubski beleuchtet ein mitunter mafiöses Geschäft, bei dem für einzelne Grillen horrende Geldsummen bezahlt werden, und gibt Einblick in eine wenig bekannte Variante der in China so verbreiteten Spielsucht.
Es gelingt ihr aber auch, die in der Tradition verankerte Poesie bei ihrer Darstellung der Insekten nachzuempfinden. So präsentiert sie, neben präzisen dokumentarischen Bildern, eine Reihe von Meditationen über das Zusammenspiel von Ästhetik und Symbolik. Die Lotusblüte, umrahmt von einer Welschen Mispel, steht nach chinesischer Lesart für die Fülle des Sommers und die Harmonie. Und die kleine Grille könnte man als einen Schönheitsfleck bezeichnen: Er steigert das Glücksgefühl, das die sich öffnende Blume vermittelt, und erinnert zugleich an deren Vergänglichkeit.
Langer Schatten

Hans Peter Klauser, Waldspaziergang, Schweiz, 1933.
Eine geheimnisvolle Unruhe erfüllt die Szene, die Hans Peter Klauser zu Beginn der 1930er Jahre in der Nähe von Zürich fotografierte. Liegt es an der tief stehenden Sonne, die das Paar wie ein Scheinwerfer von der Seite her beleuchtet, so dass ihre langen Schatten auf den Boden und auf das dichte Geäst im Hintergrund fallen? Oder sind es die Bewegungen der beiden Figuren, die diesem «Waldspaziergang» alle Gemütlichkeit nehmen? Das Paar scheint in Eile zu sein: Die schwingenden Arme der Frau deuten auf einen schnellen Schritt, und der Mann hält wohl seinen Hut in der Hand, damit er ihm nicht vom Kopf fliegt. Irritierend vor allem die dritte Figur im Bild: Wie ein Phantom legt sich der Schatten des Fotografen über den hellen Mantel seines vorbeihuschenden Gegenübers – das Fotografieren wird fast zu einem physischen Akt.
Hans Peter Klauser (1910–1989) gelang diese Aufnahme, als er noch im Ingenieurstudium war, wobei er sich schon damals mehr mit technischen Fragen rund um die Fotografie befasste als mit seinem Studium. Dieses brach er 1935 ab, um sich bei seinem Vorbild Gotthard Schuh zum Fotografen auszubilden. Seinen Lebensunterhalt bestritt Klauser mit Reportagen, als Werkfotograf in der Industrie und als Spezialist für fotografische Grossformate.
Doch sein wahres Talent zeigte sich, wenn er seinem Hang zur Poesie nachgehen konnte. Auf viele seiner atmosphärisch dichten Bilder, entstanden in den Strassen von Zürich oder Paris, trifft die Bezeichnung «poetischer Realismus» zu. Im Bild «Waldspaziergang» bleibt das meiste unaufgelöst – von der Identität der Figuren bis zur Frage nach ihrer Beziehung; umso mehr regt es zum Phantasieren an.
Der unsichtbare Feind

Tomas Wüthrich, aus der Serie «Hof Nr. 4233», 1999/2000.
Die ungemähte Wiese füllt den grössten Teil des Bildes: ein vom Wind zerzaustes Fell, ohne klare Ausrichtung und ohne Tiefe. Im Vordergrund neigen sich die Gräser in alle Richtungen, im Hintergrund verdichten sie sich zu einem Horizont aus feinsten Strichen, darüber hängt ein stumpfer, grauer Himmel. Ungemütlich wirkt diese Szene vor allem wegen der Bäuerin, die wie ein mittelalterlicher Krieger durch die Landschaft stürmt. Die Heugabel ist ihr Langspiess, das hohe Gras ihr Schlachtfeld, in dem der unsichtbare Feind lauert. Aber was für ein Kampf wird hier ausgetragen? In den Jahren 1999 und 2000 machte es sich der 1972 geborene Fotograf Tomas Wüthrich zur Aufgabe, die Auflösung des elterlichen Bauernhofs in Kerzers mit der Kamera zu begleiten – stellvertretend für Tausende von Höfen, die in den 1990er Jahren aufgegeben werden mussten.
Für ihn ging es aber nicht nur um eine soziologische Studie zur Agrarreform oder ein zeitgeschichtliches Dokument des «Bauernsterbens». Vielmehr setzte er sich auf diese Weise nochmals mit Haus, Stall, Vieh und dem Terrain seiner eigenen Kindheit auseinander, mit dem dreissigjährigen Kampf seiner Eltern ums wirtschaftliche Überleben. Sein visuelles Tagebuch ist die Aufarbeitung einer Zeit, die vom verzweifelten Festhalten an einer überholten Lebensform geprägt war. Die Fotografien, die er erst zwanzig Jahre später in einem Buch mit dem lapidaren Titel «Hof Nr. 4233» zusammenfasste, zeigen eine eindrückliche Mischung aus emotionaler Nähe und nüchterner Distanz. Manchmal sind sie rätselhaft-hintergründig, dann wieder zärtlich und mitfühlend. Die Mutter, die gegen den unsichtbaren Feind zu kämpfen scheint, findet ein Pendant im Fotografen, der mit der Kamera die Geister seiner Kindheit zu bannen versucht.
Im Karo vereint

Gebrüder Bruder: Frauen mit Kind, Daguerreotypie, 1850er-Jahre. Das Original dieser Daguerreotypie ist derzeit zu sehen in der Ausstellung «Nach der Natur. Schweizer Fotografie im 19. Jahrhundert» in der Fotostiftung Schweiz, Winterthur (bis 30. Januar).
Was zuerst auffällt, sind die Stoffe: ein Monument aus sorgfältig arrangierten Textilien, in deren Karomuster die zwei Frauen und der Junge zu einer Einheit verschmelzen. Das Bild ist eine Daguerreotypie aus dem Neuenburger Atelier «Gebrüder Bruder», aufgenommen in den 1850er Jahren, als die Fotografie noch in den Kinderschuhen steckte. Für das nach Louis Jacques Mandé Daguerre benannte Verfahren wurden silberbeschichtete Kupferplatten verwendet, auf denen das Licht, das in die Kamera eindrang, feine Zeichnungen hinterliess. Die anschliessend fixierten Belichtungen faszinieren bis heute durch ihre Präzision und Lebendigkeit. Dass man auf diese Weise fast ohne menschliches Zutun Bilder «nach der Natur» erzeugen konnte, war in den Augen der Zeitgenossen eine Sensation.
Gross war denn auch der Erfolg bei der wohlhabenden Kundschaft, die sich die teuren Unikate leisten konnte. Über 90 Prozent der erhalten gebliebenen Daguerreotypien zeigen Porträts. Obschon die abgelichteten Personen häufig unbekannt sind, verraten sie einiges über ihr Milieu und ihre Zeit.
So lässt diese Aufnahme der Gebrüder Bruder die Vermutung zu, dass die beiden Damen Schwestern sind: Aus dem eingekauften Stoff wurden gleich mehrere Kleider genäht. Symmetrisch postiert, dominant und beschützend zugleich, zeigen die Frauen dieselbe Nähe zum Jungen.
Keine von ihnen scheint ihren eigenen Sohn zu präsentieren – dazu ist wohl auch der Altersunterschied zu gross. Haben sie den Platz der abwesenden oder verlorenen Mutter eingenommen? Das Buch als Requisit deutet auf Erziehung zu Sittsamkeit oder Frömmigkeit hin, auf Vermittlung von Kultur und Bildung. Nimmt der Knabe die prominente Rolle im Zentrum ein, weil er der Stammhalter ist? Vieles bleibt Spekulation. Aber es gibt kaum Zweifel daran, dass hier – selbst ohne klassisches Elternpaar – der Zusammenhalt der bürgerlichen Familie zelebriert wird.
Was für eine Illusion

Making of «Tsunami» (von einem unbekannten Touristen, 2004), 2015
Noch ist das Ferienparadies mit Palmen, Pool und Liegestuhl intakt, das stille Wasser lädt zum Bade. Doch die unabwendbare Katastrophe ist schon da: eine brodelnde, schmutzige, tödliche Wasserwand, welche die Idylle im nächsten Moment in eine apokalyptische Landschaft verwandeln wird. Die Aufnahme ging um die Welt, weil sie die unfassbare Gewalt jener Flutwellen sichtbar macht, die am 26. Dezember 2004 infolge eines Erdbebens über Südostasien hereinbrachen. Dass sie einem Amateurvideo entstammt, verstärkt ihre Horrorwirkung; das brutale Aufeinanderprallen von vermeintlichem Paradies und realer Hölle weckt Urängste. Dieses Bild, mittlerweile eine historische Ikone, prägt bis heute unsere Wahrnehmung des Ereignisses. Es ist Teil einer kollektiven Erinnerung geworden, in der sich Fakten und Phantasie vermischen. Dieses «Überschreiben» der Wirklichkeit durch einprägsame Fotografien ist denn auch das Thema der Arbeit «Icons», mit der das Zürcher Künstlerduo Jojakim Cortis (geb. 1978) und Adrian Sonderegger (geb. 1980) international bekannt wurde.
Ab 2012 bauten sie in ihrem Atelier Dutzende von Ikonen, die unser visuelles Gedächtnis besetzen, in aufwendiger Kleinstarbeit nach – mit Papier, Karton, Sand, Holz, Textil, Watte, Styropor, Gips, Zement, Farbe und viel Klebstoff. Aus einem ganz spezifischen Blickwinkel fotografiert, verblüffen und faszinieren die Modelle durch ihre Perfektion. Doch indem sie die verschiedenen Wirklichkeitsebenen ineinandergreifen lässt, funktioniert die lustvolle und listige Bricolage von Cortis und Sonderegger auch auf einer medienreflexiven Ebene: Das Foto von der modellhaften Darstellung einer fotografierten Szene ist das Abbild des Abbilds des Abbilds. Die Illusion, wonach eine Fotografie als wahres Zeugnis eines historischen Ereignisses gelten könnte, fällt in sich zusammen, wenn man die Werkzeuge, Materialien und andere Spuren des «Making of . . .» entdeckt. Fotografie ist immer eine perspektivische Verkürzung der Wirklichkeit.
Auf der Schattenseite

Rob Gnant: Jugendlicher Arbeiter beim Sortieren der Kohle, Borinage, Belgien, 1953.
1949 stellt der Basler Kunsthistoriker Georg Schmidt den Schweizer Fotoschaffenden ein schlechtes Zeugnis aus: Er kritisiert die «Schönfärberei» und vermisst «die eminent photographische Lust am Enthüllen bisher verbotener Wahrheiten, die eminent photographische Lust am Grauen wie an der Poesie des Zwielichthaften». Ungefähr zur gleichen Zeit macht sich eine neue Generation von Fotografinnen und Fotografen auf, die klassischen Konventionen des guten Bilds über Bord zu werfen; ihr frecher, lebensnaher und subjektiver Stil erregt Aufsehen. Einer von ihnen ist Rob Gnant, geboren 1932 in Luzern, der sich nach dem Abschluss seiner Fotografenlehre als Reporter zu profilieren hofft. Hungrig, die Welt und das Leben ausserhalb der beschützten Schweiz zu entdecken, fährt er 1953 nach Belgien und nimmt eine Stelle als «Mädchen für alles» in einem Altersheim bei Elouges an. Vor allem aber interessiert er sich für die nahe gelegene Borinage, eine Gegend mit zahlreichen Kohlengruben, die er in der Freizeit mit seiner Kamera erkundet. Für eine gute Reportage fehlen ihm indes Bilder aus dem Innern der Gruben. Weil der Zutritt für Fotografen verboten ist, lässt sich Gnant von einer Grubengesellschaft als Handlanger anstellen. Als er schliesslich einfahren darf, schmuggelt er die Kamera im Brotsack mit und fotografiert heimlich. Trotz miserablen Lichtverhältnissen gelingen ihm unter Tag und in den vorgelagerten Industrieanlagen eindrucksvolle Aufnahmen, darunter das Porträt des 14-jährigen Sohns eines italienischen Grubenarbeiters, der Kohle sortiert – wenn er 18 ist, darf auch er einfahren. Mit dieser Fotografie gibt der 21-jährige Rob Gnant eine überzeugende Antwort auf die Kritik des angesehenen Kunsthistorikers: Die Enthüllung «bisher verbotener Wahrheiten» ist darin ebenso enthalten wie die «Poesie des Zwielichthaften». Über das individuelle Schicksal hinaus steht das Bild für die damals ungern gesehene Schattenseite des beginnenden Wirtschaftswunders.
Gipsfüsse

Alberto Giacometti im Atelier in Paris, um 1960.
Das klassische Künstleratelier ist ein inspirierender Ort: ein Raum, in dem Ideen und Phantasien materielle Gestalt annehmen, von Kreativität durchdrungen und meist voller Spuren, die vom Ringen um das gültige Werk erzählen. Alberto Giacomettis Pariser Atelier war in dieser Hinsicht exemplarisch. Es war vollgestopft mit unfertigen Skulpturen, die Wände übersät mit Skizzen; die Gipssedimente, die den Boden bedeckten, bildeten immer wieder neue Formationen.
Der Fotograf Ernst Scheidegger (1923–2016), ausgebildet an der Zürcher Kunstgewerbeschule und mit Giacometti befreundet, genoss einen privilegierten Zugang zu dieser magischen Welt. So durfte er 1960 in Giacomettis Atelier fotografieren, während der Meister seine ganze Energie auf eine Plastik verwendete, die für einen Platz in New York bestimmt war. Aus der damals entstandenen Fotoserie sticht eine Aufnahme heraus: Sie zeigt rechts die Künstlerbeine in gipsbesudelter Hose, links die Stelzenbeine einer Figur, die ihrem Schöpfer davonzueilen scheinen.
Die kleine Szene, die durch das seitlich einfallende Licht räumliche Tiefe gewinnt, wirkt wie eine Metapher für Giacomettis unaufhörliche Suche nach Perfektion. Der Künstler schwankte jeden Tag zwischen Erfüllung und Verzweiflung. Oft überarbeitete er das Resultat, ohne je ans Ziel zu gelangen – oder zerstörte es, um gleich darauf von Neuem zu beginnen. Vom Unvollendeten, das sich durch Giacomettis Werk zieht, erzählt auch Scheideggers Fotografie. Reduziert auf die Beine, zeigt sie Stillstand und Bewegung zugleich – als hätte der Künstler seiner Skulptur gerade Leben eingehaucht. Während er zur Säule erstarrt, stiehlt sie sich leichtfüssig davon.
Sperrige Idylle

Nicolas Faure: A9 – Le pont de Riddes, Dezember 1997.
Wie eine künstliche Kulisse sitzt das Panorama der schneebedeckten Walliser Alpen auf einem Bauwerk, das unschwer als Seitenwand einer Autobahnbrücke zu erkennen ist. Die Umkehrung der Verhältnisse ist perfekt: Nicolas Faure (* 1949) richtet seine Kamera mit Vorliebe genau auf jene Erscheinungen, die in Landschaftsfotografien meist ausgeblendet werden. Der elegant über dem Boden schwebende Betonriegel und sein Schatten sind so dominant ins Bild gesetzt, dass die gewohnte Wahrnehmung der Berge schlagartig in sich zusammenfällt.
Faure treibt die Umwertung auf die Spitze, indem er die Landschaft bei schönstem Postkartenwetter aufnimmt und seine Fotografie als grossformatiges, gemäldeartiges Tableau präsentiert.
In der Schweiz gehörte er zu den Ersten, die konsequent auf Farbe setzten. Mit umfangreichen Projekten sucht er immer wieder nach dem ungeschönten Gesicht der Gegenwart – aber nicht als Kritiker, sondern als nüchterner, unaufgeregter Beobachter von verdrängten und übersehenen Tatsachen. Faures Buch «Switzerland On the Rocks» (1992), das der zwanghaften Dekoration von Gärten mit «wilden» Felsbrocken nachgeht, fand eine Fortsetzung in «Autoland» (1999), einem Essay über die Transformation der Landschaft durch technische und bauliche Eingriffe, und schliesslich in «Landscape A» (2005), einer Arbeit über Autobahnen, zu der auch das sperrige Bild aus dem Wallis gehört.
Grosse Hände

Roberto Donetta, Bleniotal, 1904–1932.
Mit grossen, starken Fingern umfasst der Junge den Unterarm des Mädchens. Kaum zu glauben, dass die Hand diesem Halbwüchsigen gehört. In Metzgerschürze und Kittel, darunter eine Krawatte, präsentiert er sich als Lehrling oder Angestellter. Neben ihm, vom Fotografen auf die richtige Höhe gebracht, steht wohl seine Schwester. So kann sie der Junge beschützend zu sich hinziehen, sie festhalten, wie sie die Katze, die wohl lieber davonspringen würde.
Im Bleniotal, einem kargen Tessiner Bergtal, war geschwisterliche Fürsorge zu Beginn des 20. Jahrhunderts wichtig; viele Familien mussten auswandern, um zu überleben, während die Daheimgebliebenen auch auf die Arbeitskraft ihrer Kinder angewiesen waren, die einen Beitrag zur Ernährung vielköpfiger Haushalte leisteten.
Das berührende Doppelporträt ist dem Autodidakten Roberto Donetta (1865–1932) zu verdanken, der als Samenhändler regelmässig das ganze Bleniotal durchwanderte. Was er verdiente, investierte er in die Fotografie. Bald wurde der Sonderling zum Chronisten des Tales, das er kaum je verliess – mit Porträts, Hochzeitsbildern, zahlreichen Aufnahmen von Kindern, die ernst und feierlich in die Kamera blicken. Meistens sehen sie wie kleine Erwachsene aus. Doch mit der Fotografie brachte Donetta auch die Poesie ins Tal. Wenn er mit seiner schweren Glasplattenkamera auftauchte, wurde er zum Regisseur, der die Umgebung in ein Studio verwandelte, mit den wenigen verfügbaren Requisiten virtuos improvisierte und liebevolle Kompositionen erfand. Donetta war ein verkannter, zuweilen verzweifelter Künstler in einer abgeschiedenen Gegend, ganz seiner Leidenschaft und seinen Träumen verfallen. Am Ende zerbrach er daran.
Japanische Meerjungfrau

Ernst A. Heiniger, Seegras-Taucherin, Filmszene aus Ama Girls (USA, 1958), um 1956.
Wochenlang fuhren Ernst A. Heiniger (1909–1993) und seine Frau Jean die japanischen Küste entlang, um den richtigen Ort für einen Film zu finden, den sie 1956 im Auftrag von Walt Disney realisierten. Disney hatte die neue Dokumentarfilm-Reihe «People and Places» lanciert und, als er die «Weltausstellung der Photographie» in Luzern besuchte, den Schweizer Fotografen und Kameramann entdeckt.
Heiniger wurde sogleich für drei Filme engagiert – einen über die Schweiz und zwei über Japan. Der auf einem Bauernhof in Urdorf aufgewachsene Fotograf übersiedelte in die USA, begann eine Karriere in Hollywood und stellte sich begeistert den neuen Herausforderungen. Für «People and Places» eignete sich Heiniger zum Beispiel das neuartige Cinemascope-Verfahren mit Breitbild an, wofür es damals nur Farbfilme mit schwacher Lichtempfindlichkeit gab. Dem dokumentarischen Ansatz zum Trotz arbeitete er mit studioähnlichen Inszenierungen und künstlichem Licht, um den technischen Mangel des Filmmaterials auszugleichen.
Eine Tagesreise westlich von Tokio fand Ernst A. Heiniger einen Ort nach seinen Vorstellungen: das archaisch wirkende Fischerdorf Inatori. Er wählte einige Dorfbewohner aus, arrangierte sie zu einer Familie und liess sie ihren «authentischen» Alltag spielen. Yukiko – im richtigen Leben eine 18-jährige Friseuse – gehört im Film zu den mit besonderen Fähigkeiten ausgestatteten Taucherinnen. Minutenlang bleiben sie unter Wasser, um das begehrte Seegras zu ernten.
Der 30-minütige Film «Ama Girls» wurde 1959 mit einem Oscar ausgezeichnet und beflügelte Heinigers weitere Karriere. Zwischen den Dreharbeiten waren am Set auch zahlreiche Fotografien entstanden, wie diese Aufnahme der gerade dem Meer entstiegenen vermeintlichen Taucherin. Als eine Art Meerjungfrau verkörpert sie ein Phantasma: schön, geheimnisvoll, exotisch und unnahbar.
Perfekt zerstört
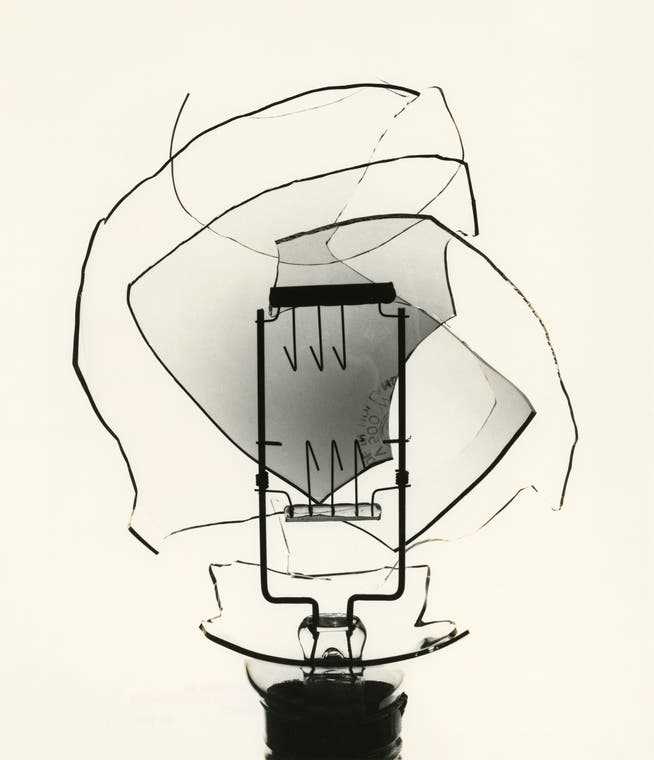
Luzzi und Michael Wolgensinger, Glühbirne, 1968
Die zerbrochene Glühbirne wirkt wie eine Antwort auf Hans Finslers Ikone der makellosen Eier. In dessen Fotoklasse an der Zürcher Kunstgewerbeschule lernten sich Luzzi Herzog (1915–2002) und Michael Wolgensinger (1913–1990) kennen. 1936, zwei Jahre vor ihrer Hochzeit, gründeten die beiden ein Atelier für Sachaufnahmen, Bildberichte und Werbung.
In den folgenden fünf Jahrzehnten mussten sich die Bildideen an die Ästhetik der Zeit und die Wünsche der Kundinnen und Kunden anpassen: Es entstanden üppige, zum Teil humoristische Inszenierungen der zu bewerbenden Objekte; auch für Farbfotografie wurde das Atelier Wolgensinger bekannt. Doch die Aufnahme der Glühbirne aus dem Jahr 1968 paraphrasiert die Neue Fotografie der 1920er und 1930er Jahre: In grösster Präzision wurden die Scherben so angeordnet, dass sie doch an eine kompakte Birnenform erinnern. Sie wurden so gekonnt beleuchtet, dass sich die Kanten wie schwarze Linien vom weissen Hintergrund abheben und im Zentrum das Glas dunkler getönt ist.
Ein Meisterwerk der Produktfotografie, das sich aber dem Zweck der Reklame verweigert – die dargestellte Glühbirne ist zwar als solche noch zu identifizieren, aber in diesem Zustand nutzlos. Das Bild wiederum wird in dieser Kombination von Zerstörung und Perfektion zum Selbstzweck, zum Kunstwerk.
(K)ein gewöhnliches Bett
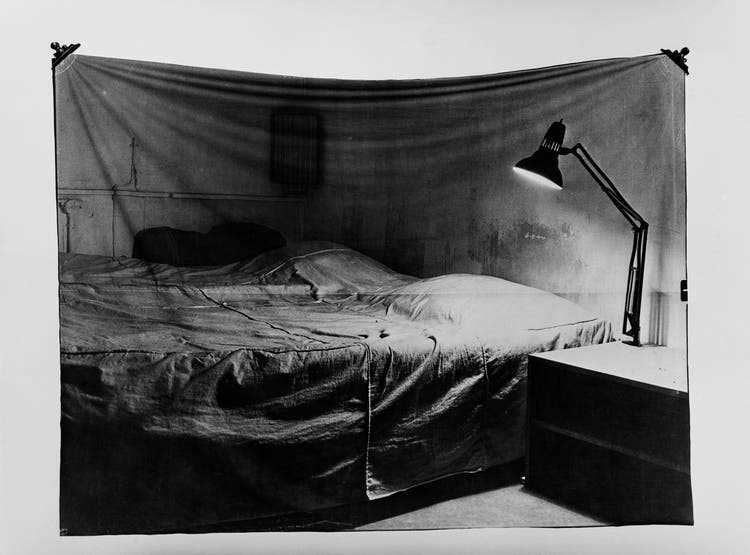
Balthasar Burkhard, Markus Raetz, Das Bett, 1969/1970.
Fotografien eröffnen Räume. Oft dringt der betrachtende Blick durch die Oberfläche des Bildes, er gilt der dargestellten Szene und ignoriert das Medium. Gegen einen solchen Zugang sträubt sich die Fotografie dieses kargen Interieurs – eine fleckige Wand, ein Bett, das von einer Schreibtischlampe beleuchtet wird.
Die Aufnahme entstand 1969, als Balthasar Burkhard (1944 bis 2010) seinen Künstlerfreund Markus Raetz (1941 bis 2020) in dessen Atelier in Amsterdam besuchte. Für eine Ausstellung im Kunstmuseum Luzern vergrösserten die beiden das Bild ein Jahr später in einer Breite von 2,60 Metern auf Fotoleinwand. Mit der ungewohnten Materialität und dem grossen Format forderten sie zur kritischen Auseinandersetzung mit der Wahrnehmung auf, ganz im Sinne des Satzes «The medium is the message» des Soziologen Marshall McLuhan von 1964.
Die abfotografierten Falten der Bettdecke und die tatsächlichen Falten der Leinwand überlagern sich, Räumlichkeit und Oberfläche vermischen sich. Wenn es um die Erzeugung der perfekten Illusion geht, so ist die Fotografie der Malerei überlegen. Als künstlerisches Medium jedoch musste sie sich zu Beginn der 1970er Jahre erst noch beweisen. Mit konzeptuellen und monumentalen Werken wie diesem unterwanderte das Duo Burkhard/Raetz die gängigen Sehgewohnheiten – eine Grenzüberschreitung, die der Fotografie den Weg in die Museen ebnete.
Ein ruhender Pol

Philipp Giegel, Auf dem Löwenplatz Zürich, 1950
Als Hausfotograf der Schweizerischen Zentrale für Verkehrsförderung prägte Philipp Giegel (1927–1997) 43 Jahre lang das Erscheinungsbild der Tourismuswerbung. Der Absolvent von Hans Finslers Fotoklasse an der Zürcher Kunstgewerbeschule machte unzählige Aufnahmen von Skifahrerinnen und Wanderern vor Bergpanoramen. Besonders gern fotografierte er sportliche Wettkämpfe, die es ihm erlaubten, Geschwindigkeit und Dynamik auf spektakuläre Weise darzustellen. Auch bei der in Zürich festgehaltenen Strassenszene spielt Bewegung eine wichtige Rolle – den Mittelpunkt der Komposition jedoch beansprucht eine statuenhafte Figur: Die in Mantel und Decke gehüllte Zeitungsverkäuferin lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, während es die Welt um sie herum eilig hat.
Der Skirennfahrer auf dem Cover der feilgebotenen Zeitschrift rast gleich zweifach den Berg hinunter. Ein Passant hastet vorbei und übersieht die Protagonistin geflissentlich. Ein Fensterputzer wirbelt seinen Lappen übers Glas. Drei Menschen begegnen sich auf engstem Raum, doch keiner beachtet den anderen. Der vierte Akteur ist der Fotograf, der die Zeit anhält und sich so zum Komplizen der Zeitungsverkäuferin macht. Die Stadt ist nur indirekt und seitenverkehrt in den Schaufenstern zu erkennen. So erscheint sie flüchtiger, fragiler als die im Zentrum thronende Frau, die sich auf ihre Weise gegen die Vergänglichkeit auflehnt.
Ein Kino in vier Bildern

Werner Gadliger, aus der Maquette des Buches Begegnungen, vor 1979
Ein Clown, ein Verrückter, ein Strassenkünstler, ein Stadtoriginal? Die eigenwilligen Gesten des Mannes verweigern sich der Einordnung in bekannte Kategorien. Doch gelingt es ihm mit der seltsamen Aufführung, Passantinnen und Passanten zum Verweilen – und Mitmachen – einzuladen. Vier Aufnahmen genügen Werner Gadliger (* 1950), um die Statik der Fotografie aufzulösen. Die Bildergeschichte wird zum animierten Daumenkino. Wobei «animiert» auch mit der Bedeutung «beseelt» übersetzt werden darf: Wer durch Gadligers Buchmaquette «Begegnungen» von 1979 blättert, trifft auf höchst reale Individuen.
Es sind liebevolle fotografische Zwiegespräche, als Gleichberechtigte sind sich die Protagonisten der Annäherungen des Fotografen bewusst. Oft reagieren sie auf seine Präsenz mit Blicken oder Grimassen. «Ich fotografiere Menschen nicht, um sie blosszustellen, sondern um ihre Einzigartigkeit festzuhalten», schreibt Gadliger. Zum Auftritt kommen Originale und Aussenseiterinnen ebenso wie Künstler – Bildhauer, Malerinnen, Filmschaffende und Schriftsteller. Ob bekannt oder unbeachtet, ihnen fühlt sich Gadliger verwandt. Sein Werk liest sich wie ein Manifest für Diversität, ein Plädoyer gegen Kleingeist. Auch seine absurden Gedichte und surrealistischen Zeichnungen belegen: Hier tut sich ein grosszügiges Weltbild auf, in dem vieles Platz hat.
Rhythmik-Studie

Walter Schwabe, Rhythmik-Studie in der Tanzschule Suzanne Perrottet, 1927
Die Tänzerin beherrscht das Bild: in der Bewegung erstarrt, den Kopf wie in Trance nach hinten geworfen, einen Arm ausgestreckt, als würde sie nach einem Sonnenstrahl greifen. Ihre Hand markiert die Spitze eines kompositorischen Dreiecks, in dessen Ecken die am Boden sitzenden Elevinnen mit Zimbel, Tamburin und Triangel den Rhythmus angeben. Sie beobachten und stützen die Darstellung dieses Körpers, der sich im luftigen Hemdchen hell vom Hintergrund abhebt.
Die Rhythmik-Studie von Walter Schwabe (1887–1961) vermittelt Konzentration und Hingabe – und die Modernität der Tanzschule von Suzanne Perrottet. Sie war eine Pionierin des Ausdruckstanzes, der als Bestandteil einer lebensreformerischen Utopie entwickelt wurde.
Der klassische Aufbau der Fotografie und die technische Umsetzung als Bromöldruck stehen im Kontrast zur Radikalität des neuen Tanzes – das Bild folgt den Konventionen des Piktorialismus, dem die Malerei als Vorbild diente. Tatsächlich war Schwabe, ein gelernter Lithograf, bis 1914 in München als Maler tätig, bevor er in die Schweiz emigrierte, um nicht in den Krieg eingezogen zu werden. In Zürich betrieb er von 1915 bis 1961 ein Fotoatelier und spezialisierte sich neben Porträt-, Sach- und Modeaufnahmen auf Tanzfotografie. Offenbar war seine Faszination für die moderne Körpersprache aber grösser als sein Interesse an der Bildsprache avantgardistischer Fotografie.
Der Augenblick danach

Candid Lang, Zuschauer und Polizei nach dem Rolling-Stones-Konzert im Hallenstadion Zürich, 14. April 1967
Es war der Moment, als die Welle des internationalen Showbiz über die behäbige Schweiz schwappte, und zwar mit solcher Wucht, dass randalierende Fans aus der Bestuhlung des Zürcher Hallenstadions Kleinholz machten – das Gastspiel der Rolling Stones am 14. April 1967. Die Fotografie von Candid Lang (1930 bis 2006) dokumentiert den Auftakt zu den nachfolgenden Jugendrevolten, die etwa als «Globuskrawall» (1968) oder als «Opernhauskrawall» (1980) in die Geschichte eingingen. Das harte Durchgreifen der Stadtpolizei bildete den Nährboden für die Auseinandersetzungen, die sich häufig anlässlich von kulturellen Veranstaltungen entzündeten.
Lang war als äusserst produktiver Fotograf eine Grösse in der Schweizer Pressefotografie. Dem Ideal der Unverfälschtheit folgend, wirken seine Reportagen und Porträts zahlreicher Persönlichkeiten bis heute frisch und spontan. Die Aufnahme aus dem Hallenstadion lebt von einer besonderen Spannung: Sie zeigt aus erhöhter Perspektive eine chaotische Situation. Das Stadion ist hell erleuchtet und gleicht einem Schlachtfeld. Zwar sind die eigentlichen Ausschreitungen im Anschluss an das Konzert bereits vorüber, doch zeugen Hunderte umgestossener und zerstörter Klappstühle von der Brachialität des Geschehenen. Die Ausschreitungen rückten in den Mittelpunkt der medialen Berichterstattung, die Fans stahlen den Rolling Stones gewissermassen die Show.
Totale Vernetzung
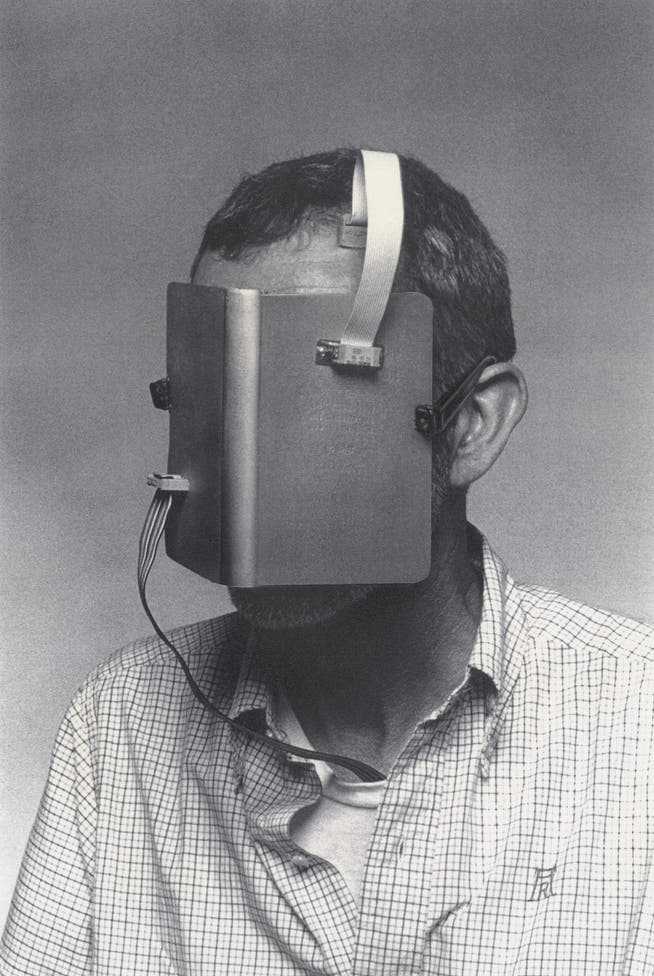
Art Ringger, Fotomontage aus der Serie Vom Bücherwald zum Datennetz, 1995
Das verkabelte Notizbuch im Gesicht des Mannes lässt uns heute an eine Virtual-Reality-Brille denken, die dreidimensionale Welten simuliert. Es verdeckt aber auch die Sicht des Mannes und hindert ihn daran, etwas wahrzunehmen. Verhelfen die elektronischen Medien zu neuen Einsichten – oder verhindern sie sie? Art Ringger (*1946) scheint diese Frage prophetisch vorwegzunehmen. Zwar hatte der Personal Computer schon 1995, als das Bild entstand, seinen Siegeszug angetreten. Seither aber ist die Ablösung der Gutenberg- durch die Turing-Galaxis exponentiell vorangeschritten: Vernetzte Computer haben das Buch als globales Leitmedium abgelöst. Ringgers Serie Vom Bücherwald zum Datennetz thematisiert diesen Medienwandel mit Witz, Scharfsinn und nicht zuletzt viel technischem Können.
Der «Fotomontör», wie er sich nannte, machte sich einen Namen als Meister der analogen Fotomontage, bevor diese durch die digitale Bildbearbeitung zum Kinderspiel wurde. Sein Werk fällt in diese Transformationsphase: Der Übergang vom Fotoabzug zur frei zirkulierenden Bilddatei hat auch seinen Umgang mit der Fotografie radikal verändert. Art Ringgers Stil ist hyperrealistisch, oft ausgehend von analogen schwarz-weissen Montagen, die er mit Airbrush-Technik handkolorierte. Ein Markenzeichen, mit dem er sein Publikum verblüffte – und das der Fotograf und Illustrator äusserst versiert zu Zwecken der Satire, Werbung und Kunst einsetzte.
Böse Überraschung

Jules Decrauzat, Absturz des Fliegers François Durafour, Collex bei Genf, 1911
Mit gebrochenen Flügeln liegt der Doppeldecker von François Durafour im Dickicht von Bäumen und Sträuchern – ein weiterer Schweizer Flugpionier hat am 23. Juli 1911 in der Nähe von Genf den Kampf gegen die Schwerkraft verloren. Der Fotograf Jules Decrauzat (1879–1960) ist auf einen Baum geklettert, um die Szene gut ins Bild zu rücken. Aus der Vogelperspektive sieht man vor allem die Sommerhüte der elegant gekleideten Personen, die sich um das Wrack drängen. Doch wer das Bild genau absucht, macht eine böse Entdeckung: In der unteren linken Ecke, halb verdeckt von Blättern, ist das Gesicht eines Mannes zu erkennen, zweifellos der Pilot. Seine Augen sind geschlossen – ist er tot?
Der aus Biel stammende und in Genf als Bildhauer ausgebildete Jules Decrauzat war der erste professionelle Fotoreporter der Schweiz. Schon um 1900 machte er sich mit packenden Momentaufnahmen einen Namen in der französischen Presse, ab 1910 arbeitete er für die Genfer Illustrierte «La Suisse Sportive» und widmete sich mit Vorliebe dem aufkommenden Flugsport. Decrauzat war ein glühender Verfechter des Fortschritts: Überall, wo Geschwindigkeitsrekorde erzielt wurden, war er dabei. Und zwangsläufig war er auch Augenzeuge von vielen Tragödien, die das neue Zeitalter mit sich brachte. In diesem Fall könnte es sein, dass der Fotograf den gefallenen Helden erst beim Entwickeln des Bilds in der Dunkelkammer entdeckte – da wusste er zum Glück schon, dass Durafour den Absturz überlebt hatte.
Sommernachtstraum

Aus der Werkgruppe Flaxen Diary, 2003.
Das ist in der Laubhütte vorgefallen, aus welcher das Mädchen mit dem Karnickel herausstürzt? Der zurückgelassene Ball deutet auf ein harmloses Kinderspiel, die sommerliche Kleidung des Kindes leuchtet in fröhlichen Farben. Doch die schnappschussartig eingefangene nächtliche Szene wirkt düster und beunruhigend. Die kleine Hexe duckt und schüttelt sich, als wollte sie sich von einer unsichtbaren Hand befreien. Sie selbst hält das zappelnde Tier am Genick – was sie ihm antut, scheint ihr selbst zu widerfahren. «We don’t see things as they are, we see things as we are», zitiert der Fotograf Christian Vogt (*1946) eine talmudische Sentenz und erklärt damit seine Beziehung zur Fotografie, sein Bewusstsein dafür, dass es keine objektive Wahrnehmung der Wirklichkeit gibt, geschweige denn eine allgemeingültige Deutung von Bildern.
Ab den 1970er Jahren machte sich Vogt einen Namen als Fotokünstler, der die vielfältigen Möglichkeiten seines Mediums ausschöpft: Er inszeniert, konstruiert, integriert Sprache und Schrift. Er schätzt aber auch das «assoziative Potenzial der Realität». So in der ab 2003 entstandenen Serie Flaxen Diary: Zufällig beobachtete Begebenheiten werden durch Beleuchtung und Ausschnitt zu rätselhaften Bildwerken, zu Fragmenten einer Erzählung. Bedeutungsvoll wird diese Erzählung jedoch erst im sinnsuchenden Blick der Betrachter.
Fotografisches Gedächtnis

Doppelwohnhaus (von Südosten), Dessau, 1926
Hinter einem Vorhang aus Föhrenstämmen stehen die Meisterhäuser. Lucia Moholy (1894–1989) hat die Not zur Tugend gemacht: Sie integriert die Bäume ins Bild. Die dunklen Stämme durchbrechen die horizontalen Linien der Bauhaus-Gebäude in Dessau und gliedern die weisse Fassade in Vierecke, das geometrische Grundelement der modernen Architektur. Die verschwommenen Büschel der Baumkronen schaffen einen Kontrast zur schonungslosen Klarheit der Gebäude. Diese müssen auf die Einwohner von Dessau einst beunruhigend modern und fremd gewirkt haben, scheinen aber in Moholys Darstellung die alte Ordnung nicht zu bedrohen.
Die Neue Sachlichkeit, hier in Architektur und Fotografie umgesetzt, war der prägende Stil am Bauhaus und wurde von der Fotografin konsequent verfolgt: Nüchtern und mit hohen Qualitätsansprüchen ging sie ans Werk, wenn sie die Objekte aus den Werkstätten ablichtete – von der Kaffeetasse bis zur Möblierung ganzer Zimmer. Ihre Bilder waren ein Instrument, mit dem das Bauhaus seine Ideen zu etablieren und seine Produkte zu vermarkten versuchte. Während ihr Mann, der Bauhaus-Lehrer László Moholy-Nagy, mit seinem experimentellen Ansatz berühmt wurde, prägt Lucia Moholy, die ab 1959 in Zollikon lebte, mit ihren Fotografien bis heute den Mythos der Avantgarde-Institution.
Männerblicke

Männerblicke, Sao Paulo, 1952.
Zielstrebig schreitet die junge Frau durch eine Gruppe von Männern. Sie hat ihre Handtasche fest im Griff und konzentriert sich auf den Boden, um keinen der vielen Männerblicke zu erwidern, denen sie ausgesetzt ist. Armin Haab (1919 bis 1991) hat diese Situation 1952 in São Paulo festgehalten. Wollte er damit den lateinamerikanischen Machismo dokumentieren? Das würde zum ethnografischen Interesse passen, mit dem Haab in vielen Ländern unterwegs war.
Der Sprössling eines Mühlenbesitzers und spätere Inhaber der Mühle war finanziell abgesichert. Er reiste, sammelte mexikanische Grafik und fotografierte. Haab war professionell ausgebildet, doch er konnte es sich leisten, seinen privaten Interessen nachzugehen – ohne Auftrag und Termindruck. Zwischen 1948 und 1969 entstand ein beeindruckendes Werk, das Haab in über 40 Kassetten zusammenfasste; einige seiner Reportagen erschienen in der Zeitschrift «Du».
Bei der obigen Aufnahme erwischte er den entscheidenden Moment. Die Protagonistin befindet sich im Zentrum, die Statisten bilden einen Kreis um sie, etliche drehen sich nach ihr um. Das männliche Verhalten wirkt zudringlich und schwärmerisch zugleich, Voyeurismus und Verehrung liegen nahe beieinander. Auch in Haabs Fotografie: Das Bild ist ein Beutestück und zugleich ein Kompliment an eine stolze, selbstbewusste Frau, die sich durch Macho-Gehabe nicht von ihrem Weg abbringen lässt.
Zauberlehrling

Jean-Pascal Imsand: Die Milchstrasse, 1987.
Soeben landet die Schattenfigur in einem Lichtnebel, erst ein Fuss steht auf der konturlosen schiefen Ebene, ihr Mantelzipfel flattert noch. Durch die flügelartig ausgebreiteten Arme scheint sie verbunden mit den Sternen über ihr, tanzt mit ihnen durch die Galaxis. Jean-Pascal Imsand (1960–1994), der Schöpfer dieses düsteren Vogelmenschen, war ausgebildeter Lithograf, profilierte sich aber ab Mitte der 1980er Jahre als Fotograf mit grösseren Essays für Publikationen wie «Du», NZZ, «Das Magazin» oder «Le Nouveau Quotidien». Zu seinen herausragenden Leistungen gehören die Montagen, mit denen er in der Dunkelkammer sein handwerkliches Können und seine imaginative Kraft bewies. In der Arbeit «Die Milchstrasse» zum Beispiel fliessen mindestens zwei Aufnahmen nahtlos ineinander, indem er verschiedene Negative nacheinander auf dasselbe Papier belichtete – ein analoges Verfahren, das digitale Techniken vorwegnimmt. Imsand liess reale Szenen perfekt miteinander verschmelzen und erzeugte so ein neues, surreales Traumbild; er schöpfte aus seinem Negativfundus und komponierte damit, wie das Hirn nachts im Schlaf, dunkle Phantasien. Man hätte Jean-Pascal Imsand noch viele brillante Projekte zugetraut. Doch 1994 nahm er sich, erst 34-jährig, das Leben. Vor diesem Hintergrund erinnert das Motiv an den Zauberlehrling, der die Geister, die er rief, nicht mehr loswird.
Im Kreis der Fotografenfamilie

Carl Taeschler (zugeschrieben): Johann Baptist Taeschler mit seinen Söhnen, Daguerreotypie gerahmt, um 1850.
Zwei Generationen einer Fotografenfamilie, die in der Schweiz zu den Pionieren zählten: Johann Baptist Taeschler (1805–1866), umgeben von seinen Söhnen Emil, Max und Ludwig. Carl, der älteste, steht wahrscheinlich hinter der Kamera. Der Uhrmacher Taeschler beherrschte die Daguerreotypie, das erste kommerziell nutzbare Fotografieverfahren, bereits wenige Jahre nach der Patentanmeldung in Paris 1839. Er bannte die Porträts vermögender Leute in dieser aufwändigen Unikattechnik auf versilberte Kupferplatten – zu Beginn als Wanderfotograf, ab 1850 in seinem Fotoatelier in St. Fiden bei St. Gallen.
Der künstlerische Anspruch offenbart sich im Firmennamen «photographisch-artistisches Atelier Taeschler», unter dem die Gebrüder Taeschler das Geschäft nach dem Tod des Vaters weiterführten. Sie waren bekannt für malerische Negativretuschen und qualitativ hochstehende Abzüge. Etwas vom Flair einer Künstlerfamilie schwingt auch in diesem für die Zeit ungewohnt zwanglosen Familienbild mit: Obschon sie lange stillhalten mussten, gruppieren sich die Knaben mit ihren eleganten Foulards gar nicht steif um den Vater, der mit seiner Hausmütze das Familiäre betont. Gleichwohl wirken die Platzierung und der Ausdruck der Hände sorgfältig einstudiert. Vermutlich ist es nicht das erste Mal, dass sie vor der Kamera posieren.
Solche privaten Familienbilder finden erst knapp 40 Jahre später, mit der Einführung von Handkameras und Rollfilm, allgemeine Verbreitung. Bemerkenswert ist, dass die weiblichen Familienmitglieder zwar tüchtig zum Geschäftserfolg beitrugen, aber weder im Bild noch in der Familienchronik einen entsprechenden Platz finden.
Wind vom Süden

Anny Wild-Siber: Ginster.
Im piemontesischen Frühsommer fing Anny Wild-Siber (1865–1942) ein eigenartiges Bild ein: eine mediterrane Landschaft mit sanften Hügeln und Zypressen, eingerahmt von einem blühenden Ginsterstrauch und einem sich im Wind wiegenden Zweig eines Baumes. Während die Schärfe der Aufnahme dem Ginster vorbehalten ist, erscheint die Landschaft derart entrückt, als handle es sich um einen gemalten Hintergrund. Die samtene Farbigkeit der Fotografie trägt zur traumhaften Stimmung bei.
Die gedämpfte Buntheit ist typisch für die Autochromplatten, die 1907 auf den Markt kamen und es auch Laien erlaubten, in Farbe zu fotografieren. Für das Verfahren wurden die Glasplatten, die als Träger der lichtempfindlichen Emulsion dienten, zusätzlich mit einer Schicht orange, grün und violett gefärbter Kartoffelstärkekörnchen überzogen. Diese wirkten als Lichtfilter und erzeugten einen pointillistischen Farbeffekt.
Anny, die jüngste Tochter des Zürcher Seidenfabrikanten Siber, hatte 1893 Emilio Wild geheiratet und war mit ihm nach Norditalien gezogen, wo er erfolgreich in der Baumwollindustrie geschäftete und sie sich – finanziell abgesichert – der Kunst widmete: Erst malte sie Stillleben und kopierte alte Meister, später fotografierte sie. Dank der Autochrom-Erfindung der Gebrüder Lumière kamen ihre Landschaften und Blumenarrangements der Malerei erstaunlich nahe.
Die Leichtigkeit des Seins

Martin Glaus, Stadt-Spielplatz, Nizza, 1948.
Drei Jahre nach Kriegsende fotografiert der aus Thun stammende Martin Glaus (1927– 2006) eine unspektakuläre Strassenszene in Nizza: Durch ein grosses Eisentor, dessen Scheiben teilweise herausgeschlagen sind, fällt der Blick auf spielende Kinder, ärmliche Fassaden, eine gepflasterte Strasse und die darüber hängende Wäsche. Das Tor beansprucht den grössten Teil der Bildfläche; Fetzen abgerissener Plakatierungen fügen sich mit der Gitterstruktur zu einem abstrakten Muster, das sich fast organisch mit dem Geschehen auf der Strasse und den Textilien in der Luft verbindet. Die Überlagerung der verschiedenen Ebenen verstellt die freie Sicht – eine Dekonstruktion, die vor Augen führt, dass Fotografie immer nur fragmentarisch sein kann. Glaus, der gerade erst seine Ausbildung abgeschlossen hat, scheint mit seiner Kamera eher zu registrieren als zu fokussieren. Er gehört zur Generation junger Fotografinnen und Fotografen, die sich nach dem Krieg mit einer «Subjektiven Fotografie» von der sauberen, sachlichen, beschönigenden und blutleeren Fotografie ihrer Väter abwendet.
Der Bildtitel Stadt-Spielplatz ist mehr als eine Inhaltsangabe; darin steckt auch ein generelles Interesse am städtischen Alltag, in dem Öffentliches und Privates auf engem Raum zusammenkommt und das Nebeneinander verschiedener Lebenswelten unvorhersehbare Bilder ermöglicht – ein anregendes Umfeld für eine lyrische, expressive Fotografie, bei der das persönliche Seherlebnis wichtiger ist als die objektive Abbildung. Glaus beobachtet die Kinder auf der Strasse aus respektvoller Distanz, ohne sie beim Spiel zu stören. Eingerahmt von grauen und schwarzen Feldern vermitteln sie eine Ahnung von der Leichtigkeit des Seins.
So fern, so nah




Yvonne Griss, aus der Serie «Melancholie», 1988.
Fernsehen soll das Fremde in unsere Nähe rücken, die grosse weite Welt mitten in unsere Wohnzimmer bringen. Sonderlich fasziniert wirken diese vier Zuschauer jedoch nicht. Eher nachdenklich und in sich versunken. Yvonne Griss (1957–1996) interessierte sich für den Gesichtsausdruck der Fernsehenden und bemerkte dabei: «Der Mensch taucht in diesem Augenblick in einen Zustand innerer Betrachtung.» Wird der Blick in die Ferne also zur Reise zu uns selbst? Die Bilder sind Teil der Serie «Melancholie», die 1988 in der Zeitschrift «Du» erschien. Das kontrastreiche Schwarz-Weiss und die dramatische Beleuchtung durch den hellen Bildschirm, der die Porträtierten in seinen Bann zieht und von der Fotokamera ablenkt, lassen die Aufnahmen wie Filmbilder wirken.
Nach der Lehre zur Industriefotografin machte Griss ein Volontariat als Kamerafrau und arbeitete in der Filmproduktion. Die konzeptuelle Arbeitsweise und das sorgfältige Inszenieren waren ebenso Teil ihrer fotografischen Praxis. Mit viel Phantasie und Experimentierfreude illustrierte sie für verschiedene Schweizer Magazine oft abstrakte Themen. Sie setzte sich fotografisch mit der Menstruation auseinander und mit Kinderlosigkeit, erstellte aber auch eine humoristische Serie über Waffennarren oder exotische Haustiere. Griss reiste nicht in ferne Länder, auf der Jagd nach einer Fotoreportage – die Berichterstattung wurde in jenen Jahren ohnehin mehr und mehr vom Fernsehen übernommen. Stattdessen richtete sie ihren Blick auf das meist Übersehene, das Private, das Naheliegend
Modellieren mit Licht

In den 1920er und 1930er Jahren lotete eine Avantgarde die fotografischen Gestaltungsmittel aus: Ungewöhnliche Ausschnitte, Perspektiven oder Beleuchtungseffekte wurden eingesetzt, um Vertrautes überraschend neuartig, ja befremdlich darzustellen. Im Zusammenspiel des Fotografen Martin Imboden mit der Tänzerin und späteren Theaterwissenschafterin Axi (eigentlich Agnes) Bleier diente ihr Gesicht als Projektionsfläche für eine gemeinsame Inszenierung.
Martin Imboden (1893–1935) war gelernter Schreiner, musisch sehr interessiert und vielseitig begabt. Nach verschiedenen Kursen und ersten veröffentlichten Reportagen entschied er sich 1929, die Fotografie zum Beruf zu machen. Wie bereits als Lehrling ging er wieder auf Wanderschaft, diesmal mit der Kamera, und blieb bis zu seinem frühen Unfalltod ein Reisender.
Während seines Aufenthalts in Wien bewegte er sich im Umfeld der freien Tanzszene, die neue, expressive Elemente weit weg vom klassischen Ballett erprobte. Mit seinen Fotografien versuchte Imboden diesen Ausdruckstanz nicht zu dokumentieren, sondern nachzuempfinden. In der Aufnahme von Axi Bleier konzentriert sich die Expressivität auf die durch das Licht modellierten Gesichtszüge – sie kommt nicht von innen, sondern wird wie eine Maske von aussen über das Antlitz gelegt.
Imbodens Bild entlarvt die physiognomischen Klischees jener Zeit, als fotografische Porträts missbraucht wurden, um Menschen in Rassen einzuteilen und ihren Charakter zu bestimmen. Man kann seine Sphinx durchaus als Antithese zur sogenannten Typenfotografie verstehen.
Berge besetzen

Jean Gaberell, Am Gallina, um die Jahre 1914–18.
Das Hochgebirge war in früheren Zeiten eine gefürchtete, unheimliche Zone; erst im 19. Jahrhundert begannen Abenteurer, Gipfel zu besteigen. Klettern bekam eine tiefere Bedeutung: Wer oben ankam, hatte einen Sieg errungen, Aussicht und Einsicht erlangt und symbolisch das Territorium markiert.
Letzteres spielt bei der Aufnahme, die Jean Gaberell (1887 – 1949) zur Zeit des Ersten Weltkriegs am Pizzo Gallina machte, eine zentrale Rolle. Das Gotthardmassiv, zu dem der Gallina gehört, wurde damals zum Inbegriff der Alpenfestung Schweiz. Tatsächlich erkennt man bei genauerem Hinsehen, dass die beiden exponierten Figuren nicht einfach tollkühne Sportler, sondern furchtlose Wachposten sind. Wie Spielzeugfiguren posieren sie für den Fotografen und besetzen «ihren» Berg. Tief unter ihnen leuchtet ein heller Bergsee, wodurch die fast senkrechte Felswand noch dramatischer wirkt.
Jean Gaberell, dessen fotografisches Archiv verschollen ist, hatte im erfolgreichen Thalwiler Postkartenverlag Gebr. Wehrli AG gelernt, wie man mit Fotografie ein breites Publikum erreichen kann. Später profilierte er sich selber mit eindrucksvollen Bildern der Schweizer Bergwelt, in der Kriegszeit auch in militärischem Zusammenhang. Viele seiner Aufnahmen wurden in Broschüren abgedruckt, mit denen die Armee den Wehrwillen stärken wollte. Seine besten Landschaftsaufnahmen fasste er in zwei opulenten Bänden unter dem Titel «Gaberells Schweizer Bilder» (1927/30) zusammen: dank hervorragender Tiefdruckqualität ein Markstein in der Geschichte der Schweizer Fotobücher.
Aussicht und Hoffnung

Thomas Kern, Camp Canaan, Bon Repos, Haiti, 2012.
An einem improvisierten Mast flattert die Flagge von Haiti, in der tiefer liegenden Ebene sind zahllose Behausungen auszumachen. Nachdem 2010 ein Erdbeben das Land verwüstet und nach offiziellen Angaben über 300 000 Todesopfer gefordert hatte, liessen sich Zehntausende, die obdachlos geworden waren, hier nieder; sie steckten Landparzellen ab und errichteten neue Unterkünfte. Kanaan heisst das planlos entstandene Lager, doch Milch und Honig fliessen dort nicht. Es fehlt an Wasser, Elektrizität, medizinischer Versorgung, sanitären Einrichtungen, Schulen.
Thomas Kern (* 1965), Mitgründer der Zürcher Fotografenagentur Lookat Photos (1990–2004), arbeitete als Fotojournalist unter anderem in Nordirland, im Nahen Osten und auf dem Balkan. Während zwanzig Jahren kehrte er immer wieder nach Haiti zurück, um sich dem Alltag der haitianischen Bevölkerung zu widmen, abseits der scheinbar endlosen Abfolge von Katastrophen und Kalamitäten. Seine Fotografie von 2012 ist mehr als ein Dokument – sie vermittelt auch eine Stimmung. Unbeugsamkeit und Stolz, die sich in der angeschnittenen Flagge spiegeln, kommen auch in der aufrechten Haltung des Mädchens in Schuluniform zum Ausdruck. Die unscharf gehaltene Figur, die gedankenversunken einen Stift an ihre Lippen hält, blickt in die Ferne – dorthin, worauf der Fotograf den Fokus gelegt hat. So erzählt dieses Bild auch von der Hoffnung auf eine bessere Zukunft, auf Bildung, auf ein Leben in Würde. Kann dieser Traum in Haiti, wo schwarze Sklaven 1804 die Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Frankreich erkämpften, jemals Wirklichkeit werden?
Es werde Licht

Hugo Paul Herdeg, Lichtschalter, um 1945.
Längst ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir mit einem einzigen Klick die Nacht zum Tag machen können. Für diesen Komfort erfand die Schweizer Firma Feller 1932 einen Kippschalter, bei dem Form und Funktion perfekt zusammenpassten – Max Bill bezeichnete ihn als «vielleicht die endgültige Form eines elektrischen Lichtschalters überhaupt». Der Fotograf Hugo Paul Herdeg (1909 bis 1953) würdigte dieses schlichte, aus Kunstharz produzierte Objekt auf seine Weise: Er löste es aus seinem alltäglichen Zusammenhang und tilgte alle Spuren des Zufälligen. Vor schwarzem Hintergrund ins Licht gesetzt, wirkt der kleine, weisse Schalter monumental – ein Ready-made, das den Betrachtern selbstbewusst und überdeutlich entgegentritt.
Herdeg war zweifellos der richtige Fotograf für diesen Auftrag. Nachdem er in Paris mit seinen modernistischen Aufnahmen der Weltausstellung 1937 Aufsehen erregt hatte, kehrte er 1939 nach Zürich zurück, wo er eines der wichtigsten Ateliers für Sachfotografie führte. Seinem sachlich-strengen Stil, der auch surrealistische Einflüsse integrierte, blieb er treu. Herdeg ging es nicht ums Dokumentieren, sondern um die Konstruktion von Bildern, die das Wesen eines Objekts präzis erfassen. Stunden- oder tagelang habe er seinen Gegenstand erforscht, ihn umkreist und abgetastet, sagen ihm seine Freunde nach – bis er ihn in sich trug und ganz genau wusste, wie die gültige Aufnahme auszusehen hatte.
Hüte und Frisuren

Hansbeat Stricker, USA, 1953.
Ein fotografisches Destillat amerikanischen Grossstadtlebens Anfang der 1950er Jahre: Schulter an Schulter stehen Frauen und Männer in ihren Trenchcoats und warten. Vielleicht öffnet das Kino bald seine Türen, vielleicht geht die Schranke zum Einstieg in die Fähre gleich hoch. Von oben, durch eine Metallkonstruktion hindurch, beobachtet Hansbeat Stricker (1924–2015) Hüte und Frisuren. Oder steht er selbst mittendrin und fotografiert die Szene von unten, mit Blick in eine verspiegelte Decke? Die enge Begrenzung des Ausschnitts macht aus dem Bild ein Rätsel. Stricker hinterliess eine ganze Reihe von Aufnahmen aus New York, die mehr sind als Zeitdokumente. Sie sind geprägt von der Faszination für diese Metropole, von ihrer ikonischen Kulisse und von der Choreografie des Alltags, die Menschen zusammenführt und wieder trennt. Nach seiner Fotografenlehre in Basel arbeitete Stricker in der Reklameabteilung von Ciba, später für Ciba-Geigy. Die Aufenthalte in den USA, die Weiterbildung beim Dokumentarfilmregisseur Leo Hurwitz und die Bekanntschaft mit Herbert Matter müssen den jungen Mann nachhaltig geprägt haben. Beruflich bevorzugte er fortan das Bewegtbild, schuf Dokumentar- und Kulturfilme sowie Tonbildschauen, doch das Fotografieren gab er nie auf. Er blieb auf der Suche nach den Momenten jener Verdichtung, die seine Komposition aus Köpfen und Schultern auszeichnet.
Technik und Kunst

Stefan Jasienski, Schnellzug Bern – Thun, 1907.
Irgendwo zwischen Bern und Thun zieht eine Dampflok an einem Telegrafenmast vorbei – zwei Symbole für Mobilität und Kommunikation im angehenden 20. Jahrhundert. Das diffuse Licht und die weichgezeichnete Umsetzung verwandeln die kraftvolle Maschine in eine wolkige Schattengestalt. Die Anklänge an die Malerei sind kein Zufall. Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich der Piktorialismus etabliert: eine Bewegung von Amateurfotografen, die aus der Fotografie mehr herausholen wollten als die getreue Abbildung der Natur. Um Stimmungen zum Ausdruck zu bringen und eigenständige Kunstwerke zu schaffen, wurde besonders beim Herstellen der Abzüge grosser Aufwand betrieben. Die Aufnahme der Lokomotive machte Stefan Jasienski (1899–1990) im Alter von nur acht Jahren.
Ein fotografisches Wunderkind? Nicht ganz. Auch wenn das Bild gelungen ist, lebt es doch hauptsächlich von der künstlerischen Interpretation bei der späteren Übertragung auf Papier. Darin war Jasienski ein Meister. Schon als Jugendlicher tüftelte er im Fotolabor und beherrschte alle möglichen Edeldruckverfahren. Dafür erhielt er internationale Preise und die Möglichkeit einer Einzelausstellung im «Camera Club of New York». Beruflich beschäftigte sich Jasienski mit der fotografischen Optik und arbeitete massgeblich an der Weiterentwicklung von Schweizer Kameramodellen mit. Es gelang ihm, Technik und Kunst zu verbinden.
Wirbel um den Mathis 333

Marcel Bolomey, Mathis 333, Pariser Autosalon, 1946.
In diesem Bild dreht sich alles um das Automobil, nämlich um den Prototyp des Mathis VL 333, der 1946 am Pariser Autosalon vorgestellt wurde. Das Fahrzeug mit dem runden Dreier-Konzept – drei Räder, drei Sitzplätze, drei Liter Benzin auf 100 Kilometer –, mitten im Krieg vom Automobilproduzenten Émile Mathis entwickelt, sollte für die breite Bevölkerung erschwinglich sein. Das stromlinienförmige Design verweist schon auf das Tempo der kommenden Epoche, und dieser Dynamik hat auch der Genfer Fotograf Marcel Bolomey (1905–2003) Ausdruck verliehen. Durch eine lange Belichtungszeit versetzt er die Messebesucher, die um dieses Objekt der Begierde kreisen, in weich fliessende Bewegungen – ein Wirbel, der die Tropfenform des Autos umso prägnanter hervortreten lässt.
Für die Massenproduktion des Mathis VL 333 erteilten die Behörden des kriegsgeplagten Frankreich jedoch keine Genehmigung. Beinahe wäre er ebenso in Vergessenheit geraten wie Bolomey selbst. Dieser begann vermutlich in den 1930er Jahren als Autodidakt zu fotografieren und arbeitete als Fotojournalist für verschiedene Zeitschriften. Zu den Höhepunkten seiner Fotografenkarriere gehören eine Reportage über die Hinrichtung Mussolinis sowie die Aufträge, die er als erster offizieller Fotograf der Vereinten Nationen erhielt. Erst vor wenigen Jahren ist sein Nachlass in den USA, wohin Bolomey 1947 ausgewandert war, wieder aufgetaucht. Eine Fülle sorgfältig komponierter Bilder voller Zeitgeschichte wartet auf ihre Wiederentdeckung.
Magie des Alltags

Annelies Štrba: Sonja mit Samuel-Maria; 1994; aus der Serie «Shades of Time».
Vier blaue Augen starren aus dem Bild. Die Mutter schaut wissend, aber unergründlich, das Kind ahnungslos und dennoch weise wie ein kleiner Buddha. Das zerwühlte Bett vermittelt eine intime Atmosphäre; die Betrachter sind mit einer ungestellten und sehr privaten Szene konfrontiert. Trotz dem Blitzlicht erhält man aber nicht das Gefühl, ein unerlaubter Eindringling zu sein. Die Fotografie «Sonja mit Samuel-Maria» ist Teil der Serie «Shades of Time» von Annelies Štrba, die 1997 als dreiteilige Diaprojektion mit 240 Bildern sowie in Buchform veröffentlicht wurde. Štrba fotografierte ab den 1970er Jahren ihre drei Kinder Sonja, Samuel und Linda obsessiv – meist in beiläufigen Situationen in ihrem Haus in Richterswil.
Auch Katzen und andere Familienangehörige sind Akteure der Bildergeschichten, die in ihrer Gesamtheit zu einem traumartigen Kosmos verwoben werden. Annelies Štrba ist die Mutter und Fotografin, die man nie sieht. Sie vermag die alltäglichen Begebenheiten in universelle Wahrheiten zu verwandeln. 1994, als ihre älteste Tochter selbst Mutter wird, verdoppelt sich der mütterliche Blick. Die Momentaufnahme von Sonja und ihrem Sohn erinnert an Andachtsbilder der Jungfrau Maria und zitiert nicht nur eines der ältesten Motive der westlichen Kunstgeschichte, sondern scheint den Ursprungsmythos der Menschheit einfangen zu wollen.
Retuscheure bei der Arbeit

Atelier Eidenbenz: Maler hinter dem Fenster, um 1940.
Die Fotografie wird häufig als Fenster zur Welt bezeichnet, und in der Geschichte des Mediums spielten Fenster immer wieder eine wichtige Rolle – so auch bei der Aufnahme aus dem Basler «Atelier Eidenbenz für Photographie und Graphik». Dieses Unternehmen, 1933 von den Brüdern Hermann, Reinhold und Willi Eidenbenz gegründet, gehörte zu den renommiertesten Werbeagenturen der Schweiz. Hier entstanden sowohl kommerzielle als auch freie und experimentelle Arbeiten. Die verschwommen wirkende Malerszene eignete sich allerdings kaum als Reklame für ein Malergeschäft, obschon sie bis ins Detail geplant wurde: Von den symmetrisch geöffneten Luken über die sorgfältig arrangierten Pinsel bis hin zur schön platzierten, dreieckigen Leiter in einem Feld von Rechtecken.
Auch die Aktion der zwei Maler, auf einem schwebenden Balken posierend, kann man als eine Gestaltungsidee verstehen, die dem optischen Verwirrspiel eine surreale, symbolische Komponente verleiht: Für einmal wurden die Retuscheure schon für die Aufnahme aufgeboten – nicht erst für die Nachbearbeitung des fertigen Bilds. Sie flecken die Fotografie sozusagen bei ihrer Entstehung aus. Die Ornamentgläser wiederum erinnern an die Mattscheibe einer Grossformatkamera, auf der sich die Wirklichkeit als mögliches Bild abzeichnet. Könnte dieses Werk eine kleine Reflexion über das Fotografieren und die trügerische Lesbarkeit der Welt sein? Ausgerechnet dort, wo zwei Durchblicke gewährt werden, ist fast nichts zu sehen.
Das ideale Objekt

Hans Finsler: Spiegeleier, 1929.
«Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose», lautet die berühmte Gedichtzeile von Gertrude Stein, die man gerne auf Hans Finslers Fotografie von 1929 übertragen möchte – ein Ei ist ein Ei ist ein Ei. Doch das wäre zu einfach. Denn Finsler, der 1932 Lehrer der Zürcher Fotoklasse wurde und Generationen von Fotografinnen und Fotografen prägte, wollte vielmehr ergründen, wie die Grammatik der Fotografie funktioniert: «Ich fragte mich, ob es nicht eine Art Grundform, ein Normalobjekt geben würde, an dem man allgemeine Gesetze der Fotografie studieren könnte, ohne durch ein besonderes Material, eine individuelle Formgebung oder eine bewusste Farbwirkung abgelenkt zu werden.» Im Ei fand Finsler den idealen Gegenstand: ein weisses, zeitloses Naturprodukt ohne Kanten und Ecken, auf dem sich die Übergänge von hell zu dunkel perfekt abzeichnen. Durch Komposition, Lichtführung, Ausschnitte oder Spiegelungen erzeugte er immer wieder neue, abstrakt anmutende Bilder, in denen die spezifischen Qualitäten der Fotografie schön zum Ausdruck kommen. Finsler nannte sein Bild augenzwinkernd «Spiegelei», doch hier geht es nicht um eine lebensnahe Darstellung eines Hühnereis, sondern um die Essenz des fotografischen Bildes. Er wolle die Objekte «aus der Unruhe des Veränderlichen und Zufälligen herauslösen», sagte Finsler und schuf damit Ikonen der modernen Fotografie.
Waghalsige Passage

Annemarie Meier: Die zerstörte Allenby-Brücke (Hussein-Brücke) über den Jordan, Jericho, 1967.
Die Zerstörung einer Brücke hat Symbolkraft. Sie versinnbildlicht wie kaum etwas den Abbruch von Beziehungen, in diesem Fall zwischen Israel und den Arabern. Die Brücke auf dem Bild ist in den Fluss, den Jordan, gestürzt. Die verbogenen Eisenträger und das Gewimmel der Menschen fügen sich zu einer kontrastreichen, unübersichtlichen Struktur aus Licht und Schatten, die fast die gesamte Bildfläche einnimmt und den Eindruck einer Situation verstärkt, aus der es kein Entrinnen gibt. Die waghalsige Passage über den schmalen Notsteg ist für die arabischen Flüchtlinge der einzige Weg vom Westjordanland nach Jordanien.
Die Fotoreporterin, die mitten im Geschehen stand, war Annemarie Meier, geboren 1943 in Zürich. Sie hatte bei Walter Binder in der Fachklasse für Fotografie an der Zürcher Kunstgewerbeschule studiert. Sie war vielseitig begabt, bewegte sich im Kunstmilieu, machte aber auch Ausflüge in die Modefotografie. 1966 dokumentierte sie in den USA Demonstrationen gegen die Diskriminierung von Afroamerikanern und die Adobe-Architektur in Santa Fe. 1967 wagte sie sich nach Israel, in den Sechstagekrieg: Ihre Bilder zeigen Operationssäle, Gefangenenlager, Tote auf den Strassen, Flugzeugwracks, Militärkonvois und immer wieder die Gesichter von Eroberern und Vertriebenen.
Dass das Engagement der Fotografin nicht mehr Beachtung fand, liegt wohl am frühen Ende ihrer Karriere: Ein Lawinenunglück riss die erst 24-jährige Annemarie Meier, die nebenbei als Schwimm- und Skilehrerin jobbte, abrupt aus dem Leben.
Schöpfung der Antimaterie

Christian Staub: «Genesis of Anti-Matter», Monroe, Washington, 1976.
Wie schafft man es, den dreidimensionalen Körper eines Hauses auf eine zweidimensionale Fläche zu reduzieren? Christian Staub (1918–2004) scheint sich mit seiner Aufnahme von 1976 diese Aufgabe gestellt zu haben. Zu sehen ist lediglich eine monochrome Fassade mit Türaussparung und angedeutetem Dach, die Fotografie selbst besteht aus lauter geometrisch aneinander stossenden Rechtecken. Nur der weisse Riss setzt einen Kontrapunkt. Wie ein Blitz schafft er eine Verbindung zwischen Himmel und Tür. Bekannt wurde Christian Staub, der in Menzingen (ZG) aufgewachsen ist, zunächst mit erzählerischen Bildern von Menschen. Sein Bildband «Circus» von 1955 zeigt den berühmten Clown Grock im Scheinwerferlicht der Manege und Artisten in intimen Momenten ausserhalb des Zeltes.
Diese Fotografien entstanden als freie Arbeiten neben seiner Anstellung als Fotograf bei einer Werbeagentur. Sein weiterer Weg führte Staub als Dozent für Fotografie ins Ausland: Nach Ulm, nach Ahmedabad in Indien und danach als Professor für (Architektur-)Fotografie an die Universitäten in Seattle und Berkeley, wo er bis Ende der 1980er Jahre lehrte. In dieser zweiten Schaffensphase wird der Mensch ausgespart und die von ihm gebaute Umwelt rückt in den Fokus. Staub interessiert sich für Randerscheinungen der Architektur, abweisende Orte mit zugemauerten Fenstern, öde Parkplatzflächen und menschenleere Kreuzungen. Er untersucht Gesetzmässigkeiten und Zeichenhaftigkeit der urbanen Welt; seine Bildtitel geben banalen Erscheinungen tiefere Bedeutung.
Mehr Masken als Gesichter

Franz K. Opitz: Guggenmusik, Luzern, um 1960.
Die Szene ist verwirrend: Blickt man hinab in Dantes Inferno? Oder wohnt man einem mexikanischen Totentanz bei? Die zigfachen Spiegelungen und Schattierungen von tiefem Schwarz bieten dem Auge keinen Halt. Einzig das Weiss der Gebeine sticht hervor. Sie schweben über dem regennassen Boden, während sie uns mit ihren Blasinstrumenten verhöhnen – unheimlich ist das. Franz K. Opitz (1916–1998), geboren in Zürich, liebte das Skurrile und Bizarre. Er fand es im Schweizer Brauchtum: Appenzeller Silvesterkläuse oder die Luzerner Fasnacht waren seine bevorzugten Motive. Und auch dem Zirkus mit seinen Schaustellern, Clowns und Akrobatinnen widmete er 1960 einen zauberhaften Bildband. Es war die Illusion, der Opitz huldigte, der entlarvende Blick hinter die Kulisse interessierte ihn nicht. Im Gehäuse seiner Leica fand das Wundersame, Magische und Absonderliche ein sicheres Refugium, von dem das rationale Denken ausgeschlossen blieb. Er nutzte dafür nicht nur die Mittel der Fotografie, zu der er erst in den fünfziger Jahren fand, sondern auch die Malerei, die Dichtkunst, die Druckgrafik, die Glasmalerei und das Geigenspiel. Franz K. Opitz war ein vielseitig begabter Künstler, und vielleicht war es diese Vielfalt, die ihm den grossen öffentlichen Erfolg in einer dieser Disziplinen verwehrte.
Vogel im Käfig

Heini Stucki: Ohne Titel, 1981.
Ein Fernsehgerät, ein gerahmtes Aquarell und ein Tisch mit zwei Stühlen. Viel mehr lässt sich in diesem spartanisch eingerichteten Raum nicht ausmachen. Die Fotografie lebt von der präzisen Komposition und der Spannung des flüchtigen Augenblicks, der hier für die Ewigkeit festgehalten wurde – «versteinert» oder vielmehr «versilbert», wie Heini Stucki sagen würde. Im Mittelpunkt steht der Greifvogel, der aus seinem Bildschirm-Käfig in die Freiheit auszubrechen und auf die gemalte Landschaft des benachbarten Bildes zuzufliegen scheint. Stucki (*1949) versteht es, den Blick immer wieder auf beinahe metaphysische Momente zu lenken, surreale Situationen, wie sie uns ständig begegnen, ohne dass wir sie bewusst wahrnehmen. Seine Bilder oszillieren zwischen Nüchternheit und Traumwelt, oft unterlegt mit leisem Humor. Stuckis bevorzugtes künstlerisches Ausdrucksmittel ist die analoge Schwarz-Weiss-Fotografie. Damit gelingt ihm eine Form von Reduktion, die auch zur Reflexion über das eigene Medium einlädt: Wirkt dieses scheinbar fensterlose Zimmer nicht wie eine Camera obscura, der Bildschirm wie der Sucher einer Kamera? Und erweist sich dieses kleine Fenster zur Welt, das sich auch noch auf der Tischplatte spiegelt, letztlich nicht als ein Trugbild? Der Vogel im TV-Gerät ist ein ebenso subjektives, mediales Abbild der Wirklichkeit wie das daneben hängende Aquarell oder die vorliegende Fotografie.
Abstrakte Intimität

Gertrude Fehr: Akt (negative Solarisation), Paris 1936.
Eine prägende Figur für die Westschweizer Fotografie war Gertrude Fehr (1895–1996). Nachdem sie in München ein eigenes Fotoatelier geführt und sich auf Theaterfotografie spezialisiert hatte, wanderte sie 1933 mit ihrem späteren Ehemann, dem Schweizer Maler Jules Fehr, nach Paris aus und gründete am Montmartre die private Fotoschule Publiphot, an der sie Porträt-, Sach- und Reportagefotografie unterrichtete, ihr Mann Typografie und Grafik. Begegnete sie in dieser Zeit den neuartigen Aktfotografien von Man Ray, der Anfang der 1930er Jahre in Paris mit dem Sabattier-Effekt experimentierte? Bei der auch als Solarisation bezeichneten Manipulation wird der Abzug während der Entwicklung in der Dunkelkammer kurz dem Licht ausgesetzt, wodurch sich stellenweise Tonwerte umkehren – der Zufall spielt mit. So verliert der Körper seine Individualität; er wird zum Objekt. Gertrude Fehr arbeitete 1936 ebenfalls mit dem Sabattier-Effekt, um die Linien eines weiblichen Körpers aus dem schwarzen Fotopapier hervortreten zu lassen. Eingefroren bei einer intimen, alltäglichen Handlung, ein Wäschestück über den Kopf streifend, verwandelt sich das Modell in einen Torso, eine gesichtslose Skulptur, ein Spiel mit Linien und Schattierungen. Verfremdung und Abstraktion rücken Fehrs Fotografie in die Nähe des Surrealismus, geprägt von künstlerischen Ausflügen ins Reich des Unbewussten, des Begehrens und des Traums. Beim Ausbruch des Kriegs 1939 flüchtete Gertrude Fehr mit ihrem Mann in die Schweiz – das Interesse an den dunklen, verborgenen Seiten des Menschseins nahm sie mit. Sie gründete in Vevey eine neue Schule, die 1945 in die École des Arts et Métiers integriert wurde, und wirkte als einflussreiche Lehrerin.
«The snow must go on»

Jules Spinatsch: Unit BT, Davos, 2004.
Ein perfektes Bühnenbild: im Vordergrund eine hölzerne Theke im Holzfäller-Stil, im Zentrum das Skelett eines knorrigen Baums, im Hintergrund die mit Scheinwerfern ausgeleuchteten Pisten, präpariert für den nächtlichen Showdown. Welches Stück wird hier gespielt? Der 1964 geborene, aus den Bergen stammende Jules Spinatsch hat während Jahren die Transformation seiner heimatlichen Landschaft beobachtet und fotografiert – und dabei immer wieder festgestellt, dass von der Natur nicht mehr viel übrig geblieben ist. Seine zwischen 2001 und 2008 unter dem Titel «Snow Management Complex» realisierten Projekte sind eine tiefschürfende Untersuchung der Infrastrukturen, Geländesimulationen, Werberequisiten sowie der Illusionsmaschinerie, die der Vermarktung von Tourismusorten und der medialen Überhöhung von Sportanlässen dient. Fehlen die Akteure, erscheint diese Landschaft als trostlose Geisterbahn – die Kehrseite der Freizeit- und Eventgesellschaft. Mit kühlem Blick berichtet Spinatsch von der «Wertschöpfung am schiefen Acker» (so der Untertitel seiner Werkgruppe) und spielt damit auf die jahrhundertealte Bewirtschaftung der Alpen an. Der Acker spielt heute kaum mehr eine Rolle. Umso wichtiger ist der Schnee: Wo sich einst Bergbauern abrackerten, liefern heute Kanonen den Rohstoff, den Pistenfahrzeuge bearbeiten und beleuchten, um unsere Klischees zu füttern.
Vom Fliegen träumen

Bruno Kirchgraber: Zürich, 1958.
So leicht sieht es aus, wenn eine Möwe über der Limmat schwebt. Vielleicht klappt es mit dem Fliegen, wenn man sich nur redlich drum bemüht? Die beiden Frauen scheinen es zu versuchen. Die Dame im Vordergrund streckt mit konzentriert gesenktem Blick die Arme wie Schwingen von sich. Die andere strebt in Richtung Himmel, und ihre Füsse lösen sich schon beinahe vom Boden. Oder könnte es sein, dass die erste Enten und Schwäne auf dem Fluss füttert, während die zweite dem fliegenden Vogel Brosamen entgegenwirft? Wie auch immer, die Konstellation ist perfekt, der Fotograf hat sie im richtigen Augenblick erhascht. Der gelernte Kartolithograf Bruno Kirchgraber (*1930) besitzt die besondere Gabe, solche Momente zu erkennen und sie in formvollendete Fotografien umzusetzen. Oft mischt sich eine Note zarten Humors in seine Bilder. «Als Fotograf lief ich mit umgehängter Kamera traumwandlerisch durch die Gegend, bis ein bestimmtes Sujet, ein menschliches Vorkommnis mich aufweckte. Dann allerdings schaltete ich blitzschnell um», sagt Kirchgraber. Auf seinen Streifzügen durch den Schweizer Alltag sucht er im Gewöhnlichen das Aussergewöhnliche. Ab den 1960er Jahren entsteht ein umfangreiches Werk, das er in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht – es sind Einzelbilder, die nicht von grossen Ereignissen, sondern vom skurrilen Theater erzählen, das sich jeden Tag vor unseren Augen abspielt. Man muss es nur sehen.
Sog in die Tiefe

Martin Hürlimann: Pfeilerhalle des Grossen Tempels, Rameswaram, Indien, 1926/27.
Als Martin Hürlimann (1897–1984) 1926 nach Indien reiste, war dieses Land für das Schweizer Publikum ein unerreichbares Märchenland, von dem es sich mittels publizierter Fotografien ein Bild machte. Der Journalist, Buchautor und spätere Verleger von Bildbänden, der sich das Fotografieren autodidaktisch beigebracht hatte, fixierte sich aber nicht auf die alltägliche Exotik oder touristische Genreszenen. Seine zahlreichen Architekturaufnahmen bleiben auch in der Fremde den Grundsätzen der modernen, sachlichen Fotografie der 1920er Jahre verpflichtet: «Die Rücksicht auf den Architekten oder Bildhauer scheint mir massgebender als der fotografische Effekt.»
Präzis und detailgetreu, statisch und symmetrisch, harmonisch und ausgewogen dokumentierte Martin Hürlimann den mächtigen Säulengang des Tempels von Rameswaram auf der Insel Pamban zwischen Indien und Sri Lanka – eine der wichtigsten hinduistischen Pilgerstätten. Die Aufnahme ist ein historisches Zeugnis des damaligen Zustands dieses uralten Bauwerks. Gleichzeitig durchdringt dieses Bild eine eigenartige Magie. Die dichte Abfolge reich verzierter Sandsteinsäulen erzeugt einen schwindelerregenden Sog in die Tiefe. Licht und Schatten halten sich die Waage, die Aufnahme wirkt wie Negativ und Positiv in einem, und so verleihen die hell leuchtenden Absätze des Unterbaus der Architektur eine spirituell anmutende Schwerelosigkeit: «Indem ich das Schöne festzuhalten versuchte, wollte ich zugleich etwas von der Seele Indiens zur Anschauung bringen.»
Viele Grüsse von Josef

Unbekannter Fotograf, Rorschach, 1918.
Ein helles, provisorisch eingerichtetes Krankenzimmer, Wandschmuck und Blumen, Suppenschüsseln auf dem Tisch. Vier junge Männer liegen unter Schweizer Militärdecken in ihren Betten und blicken in die Kamera – nur einer richtet sich auf. Die Krankenschwester, die im Moment der Aufnahme ihren Kopf dreht und daher unscharf abgebildet ist, lässt die Fotografie spontan und ungekünstelt erscheinen. Bedeutsam wird sie aber erst durch den ungelenk geschriebenen Text auf ihrer Rückseite: «Rorschach, 2. November 1918. Bin schon 14 Tage im Krankenzimmer grippekrank, aber jetzt geht es schon ziemlich besser, meine Fieber sind verschwunden, nächsten Donnerstag komme ich für 10 Tage nach Walzenhausen zur Wiedererholung. Viele Grüsse von Josef».
Die Aufnahme stammt von einem der vielen Amateure, die zur Zeit des Ersten Weltkriegs die Fotografie als Medium für bildhafte Kurznachrichten verwendeten – Instagram vor hundert Jahren. Zu Tausenden wurden solche Grussbotschaften von den Soldaten aus dem Dienst nach Hause geschickt. Wer einen Fotoapparat besass und Zugang zu einer Dunkelkammer hatte, konnte individuelle Fotopostkarten in kleinen Auflagen produzieren und sie den Kameraden schenken oder verkaufen, damit diese ihren Lieben einen Einblick in ihren Alltag geben konnten. Wichtig war dabei nicht die Ästhetik oder die fotografische Perfektion, sondern das Lebenszeichen des Absenders.
Nach vier langen und entbehrungsreichen Kriegsjahren forderte die ab 1918 grassierende Pandemie mehr Tote als der Krieg selbst; in der Schweiz starben rund 25 000 Menschen an der Spanischen Grippe. Josef hatte Glück.
Tausend Blicke

Vella, Bündner Oberland, 1943/44

Vella, Bündner Oberland, 1943/44

Knabe aus Vella, Graubünden, aus der Serie «Bergkinder», um 1943.

Mädchen aus Vella, Graubünden, aus der Serie «Bergkinder», um 1943.
Emil Brunner: aus dem «Bergkinder-Archiv», Vella, 1943/44.
Eine Mischung aus Neugierde, Verlegenheit und Respekt liegt in ihren Blicken: Stehen die vier Kinder aus dem kleinen Bergdorf Vella zum ersten Mal vor der Kamera? Haben sie sich speziell hergerichtet, um sich vom fremden Fotografen ablichten zu lassen? Wie lange mussten sie posieren? Die vor der Stallwand aufgenommenen Porträts sind jedenfalls keine Schnappschüsse. Vielmehr gehören sie zu einer Serie von 1700 Bildern, die Emil Brunner (1908–1996) in den Jahren 1943 und 1944 in zwölf Gemeinden des Bündner Oberlands angefertigt hatte. Jedes Mal, wenn er von einer Bergtour nach Hause zurückkehrte, suchte er sich in einem der Dörfer den geeigneten Hintergrund, um sukzessiv die ganze Jugend des Tales zu erfassen. Offensichtlich gewann er auch das Vertrauen der Dorfbewohner, für die der Besuch eines Fotografen ein Ereignis war.
Brunner fotografierte meistens frontal und aus kurzer Distanz, so dass das Bild nur die halbe Figur oder etwas mehr zeigte. Er kontrollierte Licht und Schärfe, damit die Gesichter ihre individuelle Schönheit entfalten konnten. Und er brachte auch die Kleider optimal zur Geltung – Kleider, die viel über den Alltag und die Lebensumstände der Kinder verraten.
Das in seiner formalen Strenge modern anmutende «Bergkinder-Archiv» wurde nach Brunners Tod wiederentdeckt. Für den Glarner Pressefotografen, der am liebsten um die ganze Welt reiste, war es ein Nebenprodukt ohne klare Zielsetzung. Heute erweist sich diese fein säuberlich nummerierte Porträtsammlung aber als ein einzigartiger Bilderschatz. Eine kollektive Momentaufnahme aus einem alpinen Mikrokosmos – tausend Blicke von namentlich nicht bekannten jungen Menschen, die uns wie eine Schicksalsgemeinschaft entgegentreten.
Kirschen auf Bleisatz

Carl Arthur Schmid: Kirschen, 1930er Jahre.
Die Fotografie von Carl Arthur Schmid (1874–1955) fällt in verschiedener Hinsicht zwischen Stuhl und Bank. Schmid war Bürger von Tuttlingen und führte im deutschen Schopfheim sowie in Basel ein «Atelier für moderne Bildkunst» für ein stilistisch eher konservatives Publikum. Er stand dem Piktorialismus nahe – einer fotografischen Stilrichtung, die sich an der Malerei orientierte. Ende des 19. Jahrhunderts fand sie, ausgehend von London, Wien und New York, auch in der Schweiz Anhänger, geriet aber in den zwanziger Jahren bei fortschrittlichen Fotografinnen und Fotografen zunehmend in Verruf. Schmid griff noch in den dreissiger Jahren Motive und Kompositionen der Kunstgeschichte auf und verwendete die malerisch wirkenden Druckverfahren der piktorialistischen Schule, um seine Bilder zu veredeln.
Beim Stillleben mit Kirschen liess er sich allerdings auch von der neuen, modernen Fotografie inspirieren. Klare Wiedergabe, enger Ausschnitt, ein Spiel mit begrenzter Tiefenschärfe sowie die Akzentsetzung durch Licht und Schatten betonen die sinnlich-stoffliche Erscheinung der dargestellten Objekte; die Fülle der runden, glattglänzenden Kirschen kontrastiert mit dem matten, zerknitterten Papier – vermutlich das Abendblatt der Basler «National-Zeitung». Dennoch bleibt Schmid dem «carpe diem» der barocken Malerei verpflichtet: Die reifen Früchte sind zwar ins Zeitgeschehen eingewickelt, doch von dem im Bleisatz gedruckten Text sind nur noch ein paar nichtssagende Wortfetzen zu erkennen.
Wenn das Wasser steigt

Daniel Schwartz: Bewohner eines temporären Schwemmlandeilands im Meghna, Sibchar, Distrikt Madaripur, Bangladesh, 21. September 1991.
Schon ein Vierteljahrhundert bevor die Klimajugend ihre Stimme erhob, wies der Schweizer Fotograf Daniel Schwartz mit eindringlichen Aufnahmen auf die Konsequenzen der Erderwärmung hin. Anfang der 1990er Jahre bereiste er die dicht bevölkerten Deltas Südostasiens, wo Ganges/Meghna, Irrawaddy und Mekong Schwemmlandfächer schaffen – ein Mehrfaches grösser als die Schweiz. Es ist «Land auf Wasser», geformt und dauernd verändert durch saisonale Überschwemmungen, Erosion und Zyklone und, immer mehr, Landabsenkung.
Wie eng die Bewohner dieser Deltas mit ihrem Ökosystem verbunden sind, kommt in dieser Fotografie zum Ausdruck. Drei Männer auf einer Schwemmlandinsel, einem sogenannten «char», in Bangladesh. Ihr Haus haben sie auf Pfählen errichtet, gerade so hoch, dass das aus dem Wasser auftauchende Land bis knapp unter den Boden reicht. Verschwindet das Eiland wieder, ziehen die Deltabewohner weiter, mitsamt dem Baumaterial.
Diesen temporären Zustand hält die Kamera in einer intensiven Begegnung der Blicke fest – mit Menschen, die zu den ersten Klimaflüchtlingen des 20. Jahrhunderts zählten. Umwelt und Ökologie sind auch Leitthema der 2017 abgeschlossenen Arbeit des Fotografen zum globalen Gletscherkollaps. Daniel Schwartz, ein Chronist des Anthropozäns, verbindet Anschauung und Sachkenntnis, um die unumkehrbaren planetarischen Interventionen des Menschen darzustellen.
Genreszene aus der Anbauschlacht

Marie Ottoman-Rothacher: Lützelflüh, 1942.
Auf der Ofenbank liegt der Knecht und tut so, als schliefe er; die beiden Bengel auf dem Ofensims sind von einem Geschehen ausserhalb des Bildausschnitts abgelenkt. Nur der Bub, der sich auf der obersten Etage des wärmenden Specksteinofens eingerichtet hat, fixiert die Kamera wie ein Adler von seinem Wachposten aus; das Kinn auf die Fäuste gestützt, bildet er gleichsam die Spitze einer sorgsam arrangierten Pyramide. Diese Genreszene wurde 1942 von Marie Ottoman-Rothacher (1916–2002) fotografiert. Sie begleitete einen Agronomen bei seiner Aufgabe, möglichst viele Höfe für die sogenannte Anbauschlacht zu gewinnen: Die Umstellung von Milchwirtschaft auf Ackerbau sollte in der Kriegszeit die Selbstversorgung des Landes garantieren.
Ottoman-Rothacher hatte sich zusammen mit dem Agronomen bei der Bauernfamilie in Lützelflüh einquartiert. Sie dokumentierte die Wirtschaft mit dem Vieh, die zehn Kinder am Mittagstisch, die geselligen Abendstunden und schuf dabei mitunter fast malerisch anmutende Zeugnisse des bäuerlichen Alltags. Damit trat Marie Ottoman-Rothacher in die Fussstapfen bedeutender Vertreter der sozialdokumentarischen Praxis. Was wäre aus der heute kaum mehr bekannten Fotografin geworden, wenn es für eine Ehefrau und Mutter in den 1950er Jahren einfacher gewesen wäre, sich auch beruflich weiter zu verwirklichen?
Katze, Feuer, Stahl

Kurt Blum: Katze, Stahlwerk Cornigliano, Genua, 1962.
In den 1950er und 1960er Jahren fotografierte der Berner Kurt Blum Stahlwerke in Norditalien. Aber der Protagonist dieses Bildes ist eine Katze. Was sie an diesen unwirtlichen Ort führt, bleibt der Imagination des Betrachters überlassen. Das Stahlwerk bildet den dramatischen Hintergrund für die rätselhafte Geschichte. Im Gegenlicht der funkensprühenden Hochöfen zeichnet sich ein Arbeiter als Silhouette ab. Wie ein moderner Hephaistos – oder ein Terminator? – erscheint die infernale Figur als Bezwinger des Feuers. Die Unschärfe und das Schwarz-Weiss verleihen dem Bild eine mythologische Qualität. Kurt Blum (1922–2005) drehte in diesem Genueser Stahlwerk auch den Dokumentarfilm «L’uomo il fuoco il ferro».
Neben dem Handfesten galt die Liebe des freiberuflichen Industriefotografen der Bohème: Künstler porträtierte er in ihren Ateliers und dokumentierte ihren kreativen Schaffensprozess. Was Schönheit in der Fotografie sein kann, demonstriert Blum mit dieser Aufnahme. Ihre eigenartige Anziehungskraft entspringt dem Zusammentreffen des Unverwandten, von Katze und Arbeiter. Sie begegnen sich, ohne voneinander Notiz zu nehmen. Die Szene kann als Sinnbild (post-)industrieller Existenz gelesen werden. In einer dichten Bildsprache hält Blum die Flüchtigkeit eines Augenblicks fest, in dem sich unterschiedliche Lebenswelten kreuzen.
Ein Gerippe des Fortschritts

Anton Krenn: Zeppelin LZ 129 in der Montagehalle, Friedrichshafen, 1933.
Der in Österreich geborene Anton Krenn (1874–1958) erreichte Zürich vermutlich als Schuhmachergeselle, eignete sich Stenografiekenntnisse an und stieg schon vor der Jahrhundertwende in den Journalismus ein. Bald belieferte er die Depeschenagentur, die «Basellandschaftliche Zeitung» und den «Täglichen Anzeiger für Thun» und arbeitete als Redaktor des «Boten vom Walensee». Seine Schilderungen des Brands von Zizers verschafften Krenn 1897 die Anerkennung der überregionalen und der ausländischen Presse. In den Jahren darauf griff er zur Kamera, vertrieb als Ein-Mann-Agentur aber auch die Bilder anderer. 1898 soll er das Attentat auf Kaiserin Elisabeth in Genf fotografiert haben, 1900 berichtete er über die Ermordung König Umbertos in Monza. Im Vergleich zu diesen spektakulären Ereignissen wirkt die Aufnahme mit der Beschriftung «Das Gerippe des im Bau befindlichen Riesenzeppelins LZ 129 in der Montagehalle in Friedrichshafen» von 1933 eher beschaulich. Im Gegensatz zu den Fotografien der Halle, wie sie in der Tagespresse auftauchten oder von der Lichtbildabteilung der Zeppelinwerke auf Postkarten gedruckt wurden, zeichnet sich Krenns Darstellung durch eine raffinierte Bildgestaltung aus. Sie zeigt den Zeppelin angeschnitten, so dass sich seine Struktur mit der Hallenarchitektur überschneidet, was seine Gestalt noch gigantischer erscheinen lässt. Zugangssperre und Warntafel erden die phantastische Kulisse, während die geisterhaften Beine einer Person, die sich in der langen Belichtungszeit auflösen, genau das Gegenteil bewirken. Das Bild des stählernen Gerippes trägt bereits den Augenblick seiner dramatischen Entblössung in sich: Am 6. Mai 1937 ging der Zeppelin LZ 129 «Hindenburg» bei seiner Landung in Lakehurst bei New Jersey in Flammen auf und beendete die Ära der Luftschiffe.
Ungewisse Zukunft

Theo Frey: Flühli, Entlebuch, 1947.
Das Dorf Flühli, im hintersten Entlebuch gelegen, gehört im Jahr 1947 zu den ärmsten Gemeinden der Schweiz. Diesen Ort suchte sich Theo Frey (1908–1997) aus, um über Menschen zu berichten, die nach den Jahren des Kriegs und der Krise um ihre Existenz kämpften. So auch das Ehepaar Felder, das von den kargen Erträgen eines kleinen Bauernhofs acht Kinder zu ernähren hatte. Während die Buben Josef und Toni sowie der Hund die Kamera fixieren, lässt Mutter Rosa ihren sorgenvollen Blick in die Ferne schweifen. Die Ungewissheit über ihre Zukunft steht diesen Menschen ins Gesicht geschrieben, ihre Armut lässt sich an den Kleidern ablesen.
Dennoch strahlt die Frau mit den kräftigen Armen Ruhe und Geborgenheit aus; vor dem dunklen Hauseingang scheint sie über ihr Heim zu wachen und der Not zu trotzen. In mancherlei Hinsicht erinnert sie an eines der berühmtesten und meistdiskutierten Bilder der Fotografiegeschichte, die «Migrant Mother» von Dorothea Lange. Lange hatte zehn Jahre vor Freys Reportage für die US-amerikanische Farm Security Administration die in Folge der Weltwirtschaftskrise wachsende Armut auf dem Land dokumentiert.
Dass Theo Frey seine Mappe und seinen Veston ins Bild kommen liess, ist bezeichnend für den Stil des Fotografen: Ihm war das Offenlegen der Verhältnisse stets wichtiger als das perfekte und ästhetisierende Bild. Frey verstand sich als Augenzeuge und strenger Dokumentarist – es ist, als wollte er durch seine Requisiten die Authentizität seiner Aufnahmen belegen.
Nature morte
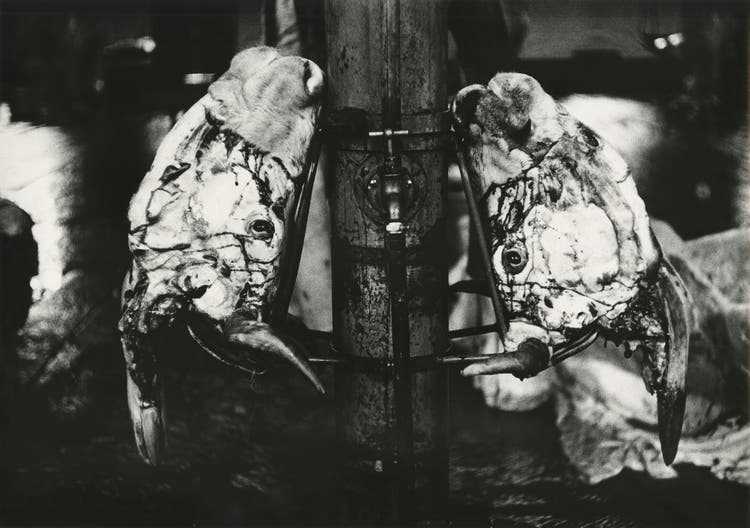
Klaus Küderli: Schlachthof Zürich, 1962.
Die Augen sind starr und leer, der Schädel mit geronnenem Blut marmoriert. Nur das Maul ist tröstlich flaumig. Es wird, wie in den sechziger Jahren noch üblich, als Ochsenmaul in der Suppe oder als Salat enden. Die beiden Rinderköpfe hängen an einer Säule im Zürcher Schlachthof. Ihre symmetrische Anordnung und die Reduktion in Schwarz-Weiss nehmen dem Bild die Spitze seines Schreckens, lassen uns aber dennoch verstört zurück. Klaus Küderli (*1937) arbeitete als gelernter Tiefdruck-Retuscheur für das Zürcher Verlagshaus und die Druckerei Conzett & Huber, bekannt für herausragende Reproduktionen von Fotografien.
Den Bildern grosser Fotografen begegnete Küderli ab 1959 bei der technischen Umsetzung der Kulturzeitschrift «Du» – sie gaben ihm den Anstoss, selber zu fotografieren. Seine Aufnahmen entstanden in der Freizeit: an Jazzkonzerten, bei Tanzabenden und auf Reisen. Aber er interessierte sich auch für den harten Kontrast zum schönen Schein der sechziger Jahre. Seine Reportage aus dem Schlachthof dokumentiert eine Arbeitswelt, deren blutige Realität im Zuge einer schnell fortschreitenden Technisierung dem Blick zunehmend entzogen wird. Zugleich wirkt diese Nature morte mit düsterer Tonalität und der Inszenierung der abgeschlagenen Köpfe wie ein Echo auf die Fotografien des Surrealisten Eli Lotar, der in den 1930er Jahren ikonische Bilder der Pariser Schlachthöfe schuf.
Tarnung und Täuschung

Christian Schwager: Infanteriebunker, Gland VD, aus der Serie «Falsche Chalets», 2001/2003, Sammlung Förderverein FSS.
Armeebunker als Chalets zu tarnen, ist gar nicht so abwegig. Dieser Haustyp war der häufigste im Alpenraum, als das Gros der Schweizer Festungsbauten entstand. Aber nicht nur hinter Chalets, auch hinter Scheunen, Ställen, Villen und Berner Oberländer Bauernhäusern verbergen sich militärische Anlagen. Zwischen 2001 und 2003 wurden sie von Christian Schwager (geb. 1966) aufgespürt und fotografiert – und zwar so, als handle es sich um idyllische Kalender- oder Postkartenmotive. Im schönsten Herbstlicht und vor blauem Himmel wirkt die vorgetäuschte Harmlosigkeit noch surrealer.
Schwagers Inventar «Falsche Chalets» (2004) beleuchtet eine Strategie des Vertuschens und Verbergens, aber auch den fragwürdigen Glauben an die militärische Unbezwingbarkeit. Alle Bauten verbindet, dass sie erst auf den zweiten Blick ihr wahres Gesicht zeigen. Sie sind kunstvoll in der lokalen Tradition bemalt oder mit Geranien geschmückt – man staunt über die Akribie und die Beflissenheit der unbekannten Dekorateure, die mit grossem Aufwand und in liebevoller Kleinarbeit zu Werke gingen. Mit dem Ende des Kalten Krieges haben viele Bunker der Schweizer Armee, die während Jahrzehnten geheim gehalten wurden, ihre Bedeutung verloren. Die Fotoserie ist damit auch ein Zeitdokument, das den geopolitischen und ideologischen Wandel spiegelt.
Die Sensenfrau

Paul Senn: Mäherin bei Schwarzenburg, um 1930.
Bildliche Darstellungen der bäuerlichen Arbeit werden gerne symbolisch gelesen. Wir neigen dazu, die enge Beziehung zur Natur zu verklären und althergebrachte Tätigkeiten wie Säen, Mähen oder Ernten metaphorisch zu deuten; die Sense wiederum wird mit dem Tod assoziiert. Auch in der Aufnahme von Paul Senn (1901–1953) schwingt etwas Archaisches mit. Und doch will sich diese Fotografie nicht recht in die abgenutzte Bauern-Ikonografie einfügen. Die unbekannte Mäherin legt mit ihrer Sense eine breite Spur durch die Wiese. Im diffusen Licht und vor dem wie gemalt wirkenden Hintergrund der weiten Landschaft gleicht sie einer Traumgestalt, einer entrückten Erscheinung, vertieft in eine Arbeit, die sonst vor allem Männern zugeschrieben wird.
Sie konzentriert sich ganz auf ihre rhythmischen Bewegungen und scheint den Schwung ihres Körpers mühelos auf das Werkzeug in ihren Händen zu übertragen. Diese Aufnahme unterscheidet sich von vielen anderen Bauernbildern von Paul Senn, der mit starken sozialkritischen Reportagen in der «Zürcher Illustrierten» bekannt wurde. In den dreissiger und vierziger Jahren bediente sich der ehemalige Reklamezeichner und Retuscheur gerne einer dramatischen, emotional aufrüttelnden Gestaltung, um seine politische Botschaft zu vermitteln. Das Bild der einsamen Sensenfrau im schlichten Arbeitskleid dagegen lebt von einer feinen, rätselhaften Poesie – wer genau hinschaut, meint das regelmässige Geräusch der scharfen Klinge beim Schneiden des Grases zu hören.
Technische Tricks und ein leuchtender Stern

Ernst A. Heiniger: Weissweinstern, 1939.
Ein Kreis, eine diagonale Linie, Glanzlichter und ein leuchtender Stern aus fein perlendem Weisswein. Der Glasbecher, der viel grösser wirkt, als er ist, wurde 1939 von Ernst A. Heiniger (1909–93) in seinem Atelier in Zürich fotografiert. Heiniger hatte sich als Vertreter einer modernen und sachlichen Fotografie in den 1930er Jahren einen Namen gemacht. Dieses Bild ist vermutlich ohne Auftrag entstanden; es ist vielmehr dem persönlichen Ehrgeiz des Fotografen zu verdanken, der sich selbst sein technisches Können beweisen wollte. Denn vieles muss zusammenspielen, um einen solchen Stern auf der Oberfläche des Weins zu erzeugen und den sogenannten «Weissweinstern» auch noch festzuhalten: Eine bestimmte Weinsorte muss unter spezifischen klimatischen Bedingungen aus grosser Höhe in ein zylindrisches Glas gegossen werden.
Der Fotograf hatte in seinem Studio aber auch mit der Wärme der Kunstlichtlampen zu kämpfen. Das Bild gelang Heiniger erst, als er auf die Idee kam, das Tageslicht mithilfe von Spiegeln einzufangen, die er im entscheidenden Moment auf das Glas umlenkte. Dabei brachte er auch noch die Eichung des typisch schweizerischen Weissweinbechers zum Leuchten: Das kleine Schweizerkreuz verspricht Qualität und Genauigkeit. Und die Zahl 39 verweist zweifellos auf das Jahr der Aufnahme – das Jahr, in dem die Welt in die Katastrophe des Kriegs raste. Ist das Bild mit dem hellen Stern auch ein subtiler Beitrag zur geistigen Landesverteidigung?
Versteckte Kamera

Yvan Dalain: aus der Serie «Geister-Express», Zürich, 1956.
Der in Avenches geborene und aufgewachsene Yvan Dalain (1927–2007) strebte eine Karriere als Schauspieler an. Doch als ihm der Durchbruch in Paris versagt blieb, bildete er sich zum Fotografen aus und machte sich in den 1950er Jahren einen Namen als umtriebiger und kreativer Reporter. Die Vorliebe für das Theatralische, das dramatische Erzählen und die gesellschaftlichen Rollenspiele blieb ihm erhalten. Im Gegensatz zu vielen zeitgenössischen Fotografen glaubte Yvan Dalain nicht an die Objektivität der Fotografie. Er scheute sich nicht, mit der Kamera spielerisch auf seine Umgebung einzuwirken oder unauffällig Regie zu führen.
In der «Woche», einer Zeitschrift für hochwertigen Fotojournalismus unter der gestalterischen Leitung von Jacques Plancherel, fand er dafür eine hervorragende Plattform – so etwa für eine umfangreiche Serie mit dem Titel «Geister-Express». Dalain lauerte den Geisterbahnfahrern auf und blitzte mit gleichbleibender Einstellung in die vorbeisausenden Gesichter, in denen sich die Lust am Schrecken spiegelt; seine «versteckte Kamera» erhaschte ein amüsantes mimisches und gestisches Spektakel. Die Intervention des Fotografen ist eine Art visuelle Verhaltensforschung, die auch an künstlerische Ansätze der siebziger Jahre erinnert. Dalain betrachtete die Welt als eine grosse Bühne und wurde nicht müde, auf dieser immer neue Geschichten zu entdecken – oder selbst zu inszenieren.
Ein ruheloses Leben

Iren Stehli: aus der Serie „Libuna“, 1974-2009.
Am Boden wartet ein Berg von Wäsche. Wenn sie ihn bewältigt haben wird, geht die Arbeit weiter: aufräumen, putzen, kochen, abwaschen, schreiende Kinder beruhigen, den Tisch für die Familie decken. Libuna hat sich hingesetzt, um eine Zigarette lang ihre Erschöpfung zu vergessen. Ein kurzes Innehalten in einem ruhelosen Leben, das Iren Stehli von 1974 bis 2009 fotografisch begleitet hat. Während andere Fotoschaffende in den siebziger Jahren ihr Glück in Paris oder New York suchten, zog Iren Stehli für die Fotografieausbildung nach Prag, in den damaligen Ostblock, wo sie noch heute lebt. Fasziniert beobachtete sie, wie sich einfache Leute mit den schwierigen Lebensbedingungen arrangierten, vor allem aber liess sie sich mit grosser Einfühlungskraft auf einzelne Menschen ein. Die Arbeit über die Roma-Frau Libuna wurde zu ihrem Lebensprojekt: Mit expressiven Aufnahmen und einem subjektiv-narrativen Stil gestaltete Stehli einen umfassenden Bildessay, in dem die Lebensstationen der Protagonistin wie in einem Film vorüberziehen. Erzählt wird von den Träumen der jungen Frau und vom harten Familienalltag, von Liebesbeziehungen, vom Verwelken der Schönheit und Libunas frühem Tod. Die 2004 als Buch erschienene Geschichte von Libuna ist ein tragisches Epos über das menschliche Dasein und ein beeindruckendes Dokument der Zeitgeschichte.
Makellose Skulpturen
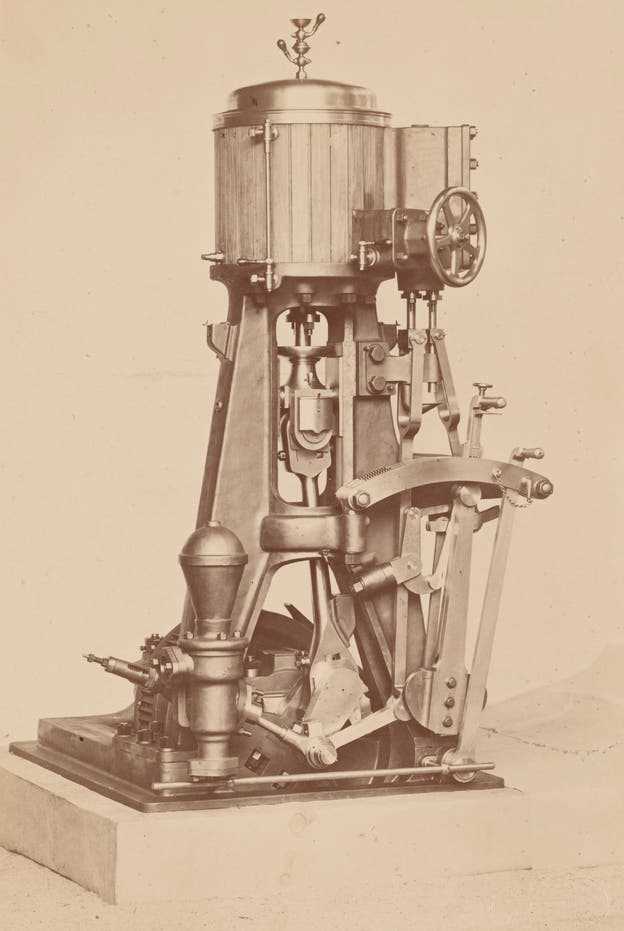
Johann Linck: Hilfspumpe, hergestellt von den Gebrüder Sulzer, um 1880.
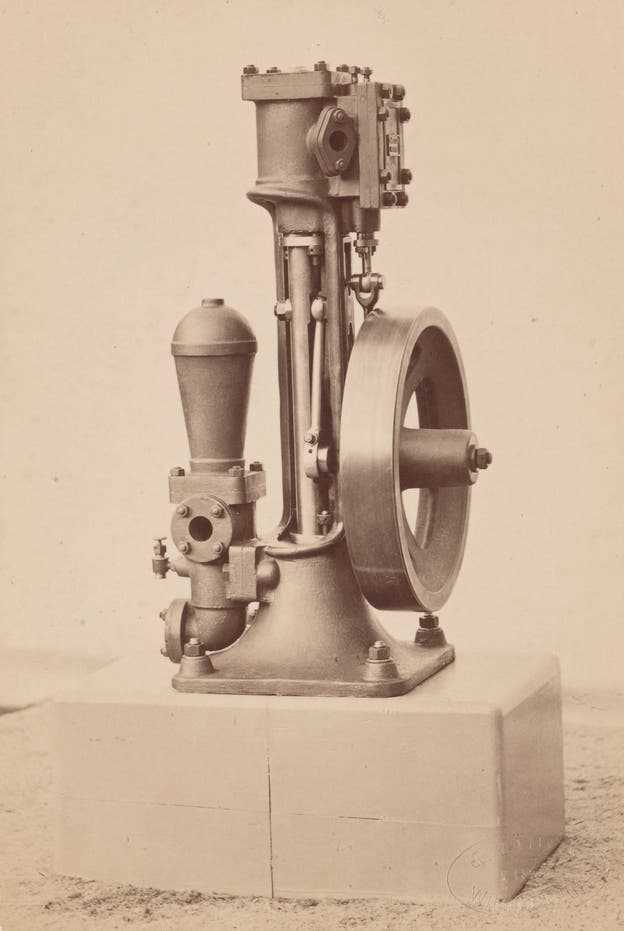
Johann Linck: Dampfmaschine, hergestellt von den Gebrüder Sulzer, um 1880.
Für die Schweizer Industriegeschichte spielt die Firma Sulzer in Winterthur eine zentrale Rolle. Schon um 1880 sind ihre Dampfmaschinen weltweit gefragt; sie werden nach Mailand, London, Kairo, Moskau oder Kobe exportiert. Der Stolz des Unternehmens spiegelt sich auch in den Aufnahmen von Johann Linck (1831–1900). Dieser verstand es meisterhaft, die Maschinen für potenzielle Käufer in Szene zu setzen: Die Vermeidung harter Schlagschatten durch perfekte Ausleuchtung und der retuschierte Hintergrund bringen Konstruktion und Funktionalität ideal zur Geltung. Linck, der in Winterthur ein prosperierendes Atelier betrieb, arbeitete nicht nur im Auftrag lokaler Fabrikanten. Schweizweit dokumentierte er den Bau von Eisenbahnbrücken, Fabrikanlagen und Gewerbeausstellungen und wurde so zum Chronisten der Industrialisierung. Seine Fotografien der dampfbetriebenen Maschinen wirken heute wie eine Verherrlichung des technischen Fortschritts, doch der Fabrikwelt sind sie seltsam entrückt: Losgelöst von Kontext und Grössenverhältnissen, stehen sie als ästhetisierte Skulpturen auf ihren Sockeln. Kein Stäubchen, kein Ölfleck auf den glänzenden Oberflächen lässt an die laute, geschäftige Werkhalle denken. Die Arbeiter, die dem Diktat der Maschinen zu folgen haben, bleiben ebenso ausgeblendet wie die Energie und die Dynamik, die von diesen technischen Meisterwerken erzeugt werden.
Die schwarze Steilwand

Hans Baumgartner: Primarschule, Rickenbach, 1934.
An Schulen haben Tablets Einzug gehalten – die bedrohliche schwarze Wandtafel, der Generationen von Schülerinnen und Schülern ausgeliefert waren, wird bald ausgedient haben. Doch die Erinnerung daran bleibt erhalten in Fotografien wie dieser von Hans Baumgartner (1911–1996), entstanden in einer Primarschule in der ländlichen Gemeinde Rickenbach bei Wil im Kanton Thurgau. Das Bild vergegenwärtigt Freuden, Tücken und existenzielle Nöte des Schulalltags: Weil dem Mädchen, den Blicken der Klasse ausgesetzt, die Kreide immer höher rutscht, ist es gezwungen, sich auf die Zehenspitzen zu stellen. Wie nur ist diese senkrechte Steilwand zu bezwingen? Die nackten Füsse lassen ahnen, dass die Aufnahme vor der Zeit des Wirtschaftswunders entstanden ist. Sie ist ein historisches Dokument – aber ebenso ein Ausschnitt aus dem Leben, der sich, auch in veränderten Zeiten und unter anderen Vorzeichen, in Schulen rund um die Welt wiederholt. Selber ein Leben lang als Lehrer tätig, vermochte Baumgartner besonders eindrückliche und aussagekräftige Bilder der Schule zu realisieren. Da sich die Kinder schnell an die Kamera im Schulzimmer gewöhnten, nahmen sie seine fotografischen Versuche mit natürlichem Vertrauen zur Kenntnis. Aber was auf den ersten Blick wie eine beschauliche Szene aus einem Albert-Anker-Bild wirkt, trägt den Reformgedanken in sich. Wenn wir Baumgartners ungezwungene Aufnahmen vergleichen mit den strengen offiziellen Klassenfotos, spüren wir sofort, dass sein Erziehungsideal dem freien Menschen galt. Bei ihm dominiert nicht die gestellte Pose, sondern der Augenblick, der Schnappschuss und das Mitgefühl. Das machte ihn nicht nur zu einem fortschrittlichen Lehrer, sondern ebenso zu einem Pionier im freien Umgang mit der Kamera.
Aufsicht und Einsicht

Georg Gerster: Brackige Tümpel bei Morawa, Westaustralien, 1989.
Flugbilder vermitteln nicht nur atemraubende ästhetische Erlebnisse, sie erlauben es auch, geografische, ökologische oder wirtschaftliche Zusammenhänge zu erkennen, die dem menschlichen Auge am Boden verborgen bleiben. Kaum eine fotografische Perspektive ruft so viel Staunen hervor wie die Sicht von oben. Georg Gerster (1928–2019) hat in einem halben Jahrhundert der Flugfotografie die herkömmliche Luftaufnahme zum Flugbild veredelt. Dabei erlangte der promovierte Germanist nicht nur technische Meisterschaft. Gerster verbindet sein Flair für Formen, Muster und Farben mit dem Drang nach Erkenntnis.
Er nutzt den Verfremdungseffekt des Luftbilds, um beim Betrachter Respekt für die Schönheit unseres Planeten zu wecken, und informiert zugleich über komplexe Themen wie Umweltschäden und Nachhaltigkeit – so etwa mit der Aufnahme der westaustralischen Steppe bei Morawa: Die Störung des ökologischen Kreislaufs durch landwirtschaftliche Übernutzung zeigt sich hier in einer starken Versalzung des Bodens, die auch die ehemaligen Süsswasserteiche erfasst. Sie färben sich entsprechend dem Salzgehalt und den unterschiedlichen Kleinstlebewesen, die sich im Brackwasser ansiedeln. Was auf den ersten Blick wie ein abstraktes Gemälde anmutet, entpuppt sich als Resultat einer von Menschen verursachten Katastrophe.
Mehr über Georg Gerster
Arme der Arbeit

Jakob Tuggener: Arme der Arbeit, 1947.
Männerarme und -fäuste stemmen ein Werkzeug, glänzende Haut spannt sich über Muskeln. Als symmetrische Skulptur erscheinen die Körperteile, losgelöst von den zwei Arbeitern, deren Gesichter abgewandt und im Schatten verborgen bleiben. Diese Lust an Fragmenten, Lichtern und Schwärzen, an der fotografischen Wiedergabe samtener, glatter oder schmieriger Oberflächen durchdringt die Bilderwelt von Jakob Tuggener (1904–1988). Nach einem gestalterischen Studium in der pulsierenden Grossstadt Berlin suchte er seinen «Augenhunger» in einem Umfeld zu stillen, das ihm schon aus seiner Lehrzeit als Maschinenzeichner bei der Maag Zahnräder AG in Zürich vertraut war: Die Fabrikarbeit wurde eines von Tuggeners beliebtesten Motiven – neben Autorennen, Flugmeetings, ländlichen Szenen und opulenten Ballnächten in luxuriösen Hotels.
Die Fotografie begriff der Exzentriker nicht als dokumentarische Illustration, sondern als Ausdrucksmittel für Stimmungen und Gefühle. Das Bild mit dem Titel «Arme der Arbeit» ist eines der bekanntesten von Tuggener, da es 1955 grossformatig in der berühmten Ausstellung «The Family of Man» im Museum of Modern Art in New York ausgestellt wurde. Einprägsam und symbolisch wird der menschliche Körper wie das Versatzstück einer Maschine dargestellt. In dieser Szene liegt etwas Glorifizierendes, aber auch etwas Unheimliches – entsprechend dem Credo des Künstlers, der fasziniert war von der Kraft der Maschinen und gleichzeitig immer wieder davor warnte, dass diese den Menschen eines Tages beherrschen könnten.
In der Falle

Schreckerfüllt blickt der Kindermörder auf. Er ist in die Falle getappt. Doch auf der Fotografie von Rob Gnant (1932–2019) steht ihm nicht die Polizei gegenüber, sondern die Filmcrew. Die Überführung des Täters, im Film so real wie möglich inszeniert, wird als Illusion entlarvt: Unscharf ragen Filmklappe und Kameraobjektiv ins Bild und scheinen den Schauspieler Gert Fröbe zu bedrohen. Der Fotograf ist im Auftrag der Zeitschrift «Die Woche» am Set von «Es geschah am helllichten Tag» und betrachtet die Szene aus der Perspektive des Kameramanns. Diesen Beruf hätte Gnant selbst gerne erlernt, wegen mangelnder Ausbildungsmöglichkeiten ist aus seinem Jugendtraum eine Fotografenlehre geworden. Film und Fotografie bleiben aber sein Leben lang miteinander verbunden: Bewegung und Unschärfe verleihen seinen Bildern Dynamik, das Fotografieren in Sequenzen lässt seinen Reportagestil filmisch wirken.
Als kritischer Zeitgenosse berichtet Gnant immer wieder über soziale Missstände – etwa mit Reportagen über die italienischen Gastarbeiter und ihren Alltag in der Schweiz. Sein feines Gespür für starke Bilder prägt auch den Film «Siamo Italiani», den Gnant 1964 mit Alexander J. Seiler und June Kovach realisiert. Die Kameraführung des Fotografen trägt dazu bei, dass dieser Film zu einem aufrüttelnden Statement gegen die damalige «Überfremdungsinitiative» wird.
Kulturelles Verwirrspiel

Namsa Leuba: Patience, aus der Serie «Zulu Kids», 2014.

Ancestors, aus der Serie «Zulu Kids», 2014.
Namsa Leuba: Zwei Arbeiten aus der Serie «Zulu Kids».
In einer ausgetrockneten Ebene, am Rande einer Industriezone, stehen auf sockelartigen Podesten menschliche Skulpturen. Bemalung, Kleidung und Schmuck der posierenden Kinder erinnern an sogenannte «Stammeskunst». Wird hier ein afrikanisches Ritual vergegenwärtigt? Was auf den ersten Blick authentisch anmutet, ist eine Fiktion der 1982 geborenen, schweizerisch-guineischen Künstlerin Namsa Leuba. Für ihre Serie «Zulu Kids» hat sie Accessoires in Guinea gesammelt und ihren Statisten in Südafrika, am andern Ende des Kontinents, übergezogen, ja übergestülpt – eine Konfrontation von Kulturen, die den meisten europäischen Betrachtern wahrscheinlich entgeht.
Die Fotografin gestaltet die Körper wie eine Bildhauerin, behandelt sie wie einen Werkstoff. Sie spielt mit Versatzstücken kultureller Identität und hinterfragt deren Bedeutung: Traditionen und Folklore sind manipulier- und instrumentalisierbar, Exotik ist ein Produkt unserer Phantasie. Bemerkenswert ist nicht nur das kulturelle Verwirrspiel, das Namsa Leuba betreibt, sondern auch das stilistische: Ihr Werk verbindet ein anthropologisch-dokumentarisches Interesse an Brauchtum mit einer ästhetischen Sensibilität, die uns eher aus der Mode- und Designwelt geläufig ist. Sie setzt Ironie und Witz ein, um nicht nur zum Schauen, sondern auch zum Nachdenken zu verführen.
Landschaft mit Dreieck

Taiyo Onorato & Nico Krebs: «Street», 2005, aus der Serie «The Great Unreal»
Es gibt wohl kaum eine Landschaft, die in einem grösseren Ausmass durch die Kamera kolonialisiert wurde, als der Südwestens Amerikas. Vermittelt durch Bilder, sind die Weite, die Leere und die gewaltige Natur zu einem Mythos geworden, der für das Land der unbegrenzten Möglichkeiten identitätsstiftend ist.Taiyo Onorato und Nico Krebs, beide 1979 geboren, unternehmen 2005 ihre erste Reise quer durch dieVereinigten Staaten in Richtung Westen. Sie begeben sich auf die Suche nach dem echten Amerika und wandeln dabei auf den Spuren von Fotografen,die vorihnen die amerikanischeLandschaft bereist haben. Das Schweizer Künstlerduo fühltsich erst unfähig, Bilder zu machen ohne notorische Repetition.
Das eindrücklichste Motiv, das die beiden Autofahrer ständig vor Augen haben, ist die Strasse, die sich in perspektivischer Verkürzung als dreieckiger Keil in die Landschaft bohrt.Für «Street» basteln sie aus Papier eine Attrappe und platzieren diese im Bildausschnitt. Onorato/Krebs nennen ihr Vorgehen eine Performance für das Auge der Kamera. Durch die Ausführung der Photoshop-Befehle «Ausschneiden»,«Kopieren» und «Einfügen» wird die Fotografie im digitalen Zeitalter parodistisch vorgeführt und das Oszillieren zwischen Illusion und Desillusion zur beabsichtigten Strategie. Dass das Ergebnis an ein ikonisches Bild von Robert Frank erinnert, ist kein Zufall.
«Luftkostüm» im Studio

F. Jenny-Becker macht Atemübungen nach Keller-Hoerschelmann, um 1913.

F. Jenny-Becker macht Atemübungen nach Keller-Hoerschelmann, um 1913.
Johann Baptist Nikolaus Schönwetter: F. Jenny-Becker macht Atemübungen nach Keller-Hoerschelmann, um 1913.
Fast nackt führt dieser bärtige Mann seine Übungen aus, streckt die Arme mit den Gewichten in den Händen, beugt die muskulösen Beine. Lange vor Leggins und Yogamatte bot ein knappes Höschen Bewegungsfreiheit, ein Teppich diente als Unterlage. Fotografiert wurde der Athlet im Studio von Johann Baptist Nikolaus Schönwetter (1875–1954) in Glarus. Normalerweise bildete der Teppich mit ein paar Möbeln die Kulisse für Porträtaufnahmen im gutbürgerlichen Stil.Der neutrale Hintergrund verleiht den Gymnastikbildern einen wissenschaftlichen Charakter, auch wenn sie aus heutiger Perspektive eher komisch wirken. Wie kommt ein Fotograf,der vor allem für seine Landschafts- und Porträtaufnahmen bekannt war, dazu, Kniebeugen zu inszenieren?
Die zwei Posen gehören zu einem 31-teiligen Leporello mit eingeklebten Originalfotografien; dieses nimmt Bezug auf den 1910 im Zürcher Verlag Luft und Sonne erschienenen Ratgeber «Mein Atmungssystem» von Dr. med. Adolf Keller-Hoerschelmann. Als Anhänger der Lebensreform-Bewegung propagierte der Arzt diese Atemübungen im «Luftkostüm» zur Förderung des allgemeinen Wohlbefindens, zur Aktivierung der Selbstheilkräfte sowie zur Befreiung von Geist und Seele. «Wollen wir in der Luftbadbewegung vorwärtskommen,so müssen wir uns eben an den Anblick des nackten Menschen gewöhnen», sagte Keller-Hoerschelmann.
Vom Fliegen träumen

Anita Niesz: Quartiers-bas, Troyes, Frankreich, 1956.
Der Mantel fliegt, Arme und Beine sind in schneller Bewegung, der zur Seite geworfene Kopf und die wehenden Haare verleihen der Figur zusätzliche Dynamik. Die junge Frau wirkt verspielt und unbeschwert, in ihrer schwungvollen Drehung verwandelt sie sich in eine Tänzerin. So wird die leere Strasse für kurze Zeit zum Ort der Träume – bevor uns die schäbigen Häuser im Hintergrund wieder in die Wirklichkeit zurückholen. Anita Niesz (1925–2013) hat diese Fotografie 1956 in Troyes aufgenommen. Die Textilstadt im Osten Frankreichs war von den Deutschen zu Beginn des Zweiten Weltkriegs schwer bombardiert worden, fast die gesamte Bevölkerung hatte die Stadt vorher verlassen.
Die Kathedrale nahm keinen Schaden, auch die Häuser im Bild scheinen intakt, doch das Gelände längs der Strasse war vor dem Krieg wohl bebaut. Abschrankungen, Geröllhaufen, die Baugrube und ein Löffelbagger lassen vermuten, dass hier neuer Wohnraum entsteht, mehr als zehn Jahre nach Kriegsende. Die Fotografin Anita Niesz reiste immer wieder nach Frankreich und Italien; sie arbeitete für die Kulturzeitschrift «Du», die NZZ und für Organisationen wie Pro Juventute oder das Kinderdorf Pestalozzi. Kinder und junge Menschen spielen in ihrem Werk eine wichtige Rolle. Das Bild aus Troyes steht für den Aufbruch einer neuen Generation in eine neue Zeit; doch es erinnert auch daran, dass nicht alle in gleichem Mass vom Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit profitierten.
Sommerfrische

Charles Weber: Aulen, Kanton Appenzell Innerrhoden, August 1989, aus der Serie «Jardin Suisse».
Blütenrein wie in der Waschmittelwerbung hängen die weissen Stoffwindeln an der Leine und strahlen mit den Schneefeldern im Hintergrund um die Wette. Die Wäscheklammern in lustigen Farben sind in regelmässigen Abständen platziert, der Boden ist tüchtig gefegt. Die Szenerie, die Charles Weber (*1947) im Appenzellischen fotografiert hat, wirkt wie eine Installation, aufgeladen mit Schweizer Klischees: phantastisches Panorama, ländliche Abgeschiedenheit, frische Luft, Genauigkeit, Ordnung und Sauberkeit. Den Autor reizt diese Ansammlung plakativer Motive, die er zur Karikatur steigert. Für seine 1989 entstandene Serie «Jardin Suisse» hat Weber die Aussenraumgestaltung im ganzen Land fotografisch untersucht.
Die Orte und Ausschnitte sind pointiert gewählt, manch skurrile Auswüchse schweizerischen Geschmacks finden sich darunter. Daneben ist in fast jedem Bild der Serie auch ein Stückchen Naturlandschaft sichtbar. Kurz vor der 700-Jahr-Feier 1991 war die Frage nach der Identität der Schweiz ein vieldiskutiertes Thema. Woran ist sie zu erkennen? An der Berglandschaft mit verschneiten Gipfeln, die schon für Generationen von Appenzellern die Kulisse ihres Lebens bot? An der Ordnung und Aufgeräumtheit? Oder an der Tendenz, die Natur in ein niedliches «Gärtli» zu verwandeln – wie es der Titel der Arbeit suggeriert –, in dem sich die Menschen ihre kleine, heile Welt einrichten?
Indien am Schicksalsfaden

Walter Bosshard: Gandhi in Dandi, Indien, 7. April 1930.
Als Walter Bosshard am 7. April 1930 im indischen Küstenort Dandi eintrifft, ist die Lage explosiv. Gandhi hat gerade den grossen Salzmarsch hinter sich – eine unerhörte, gewaltlose Provokation, weshalb er fast stündlich mit seiner Verhaftung rechnen muss. Dennoch gelingt es dem Schweizer Reporter, in den innersten Zirkel der indischen Unabhängigkeitsbewegung vorzudringen: Einen Morgen lang darf er Gandhi beim Essen, Rasieren, Lesen, Scherzen und Diskutieren fotografieren. Dabei taucht Walter Bosshard (1892–1975) selbst tief in die feierliche Atmosphäre ein. Die Konzentration des charismatischen Mahatma findet ihr Echo in den Gesichtern seiner Anhänger, die andächtig seinen Worten lauschen.
Entrückt von der brodelnden Stimmung auf der Strasse, scheinen sie sich in geistiger Disziplin zu üben – eine unbeirrt an ihren Idealen festhaltende Gemeinschaft. Der fotografierte Augenblick hat eine tiefere Bedeutung: Die Baumwolle und die handgesponnenen weissen Kleider sind Symbole des Widerstands, und Gandhis Geste scheint anzudeuten, dass das Schicksal Indiens an einem Faden hängt. Als die «Münchner Illustrierte Presse» Bosshards Bildbericht unter dem Titel «Mahatma Gandhi privat!» veröffentlicht, ist die Sensation perfekt: Die erste «Homestory» über den wohl berühmtesten Mann seiner Zeit geht um die Welt. Und sie ist alles andere als privat.
Flirren und Pulsieren

Roger Humbert: ohne Titel, 1955.
Ist dieses Bild noch eine Fotografie? Neben seiner Arbeit als Werbefotograf begann Roger Humbert (* 1929 in Basel) Ende der 1940er Jahre künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten zu erproben. Seine Experimente in der Dunkelkammer führten ihn unter anderem zum sogenannten Luminogramm: Mithilfe von Schablonen, Gittern und Plexiglas gestaltete Humbert Licht und Schatten, so dass sie sich nach seinen Vorstellungen auf dem Fotopapier abzeichneten. «Ich fotografiere Licht», so kommentierte Humbert diesen Ansatz. Mit seinen Werken gehörte er zu den avantgardistischen Vertretern der konkreten Fotografie, welche die Essenz, aber auch die Grenzen des Mediums ausloteten; ihre abstrakten Kompositionen erscheinen als grösstmöglicher Gegensatz zur dokumentarischen Fotografie, die einer äusseren Wirklichkeit verhaftet bleibt.
Neben Anordnungen und Überlagerungen geometrischer Formen entstanden auch Bilder, die wie Reflexionen synästhetischer Erfahrung wirken: Hier begegnen sich flirrende Bewegung und pulsierender Rhythmus, man denkt an Tanz und Musik, Stille und Lärm. Humbert brachte sein Interesse an einem «Sehen hinten im Sehraum» auch mit Untersuchungen zum autogenen Training in Verbindung, bei denen die Probanden optische Erlebnisse schilderten. So erinnern manche Bilder an jene Schlieren und Flecken, die wir bei geschlossenen Augen «beobachten» können.
Von irgendwo nach nirgendwo

Andreas Seibert: Vor der Abfahrt, Guangzhou, Provinz Guangdong, 2005.
Eine Szene wie aus einem Film: als hätte ein Regisseur den Reisenden zentimetergenau in den Ausschnitt des Zugfensters gerückt und die Beleuchtung von innen her sorgfältig gesteuert – aussen herrscht jenes blaugrüne Kunstlicht vor, das in Asien von der Dämmerung an allenthalben den öffentlichen Raum schummrig erhellt. Der junge Mann mit dem schönen Gesicht scheint ganz in seine Gedanken versunken. Und die epische Anmutung dieses Bildes setzt im Kopf des Betrachters eine Geschichte in Bewegung: Sie erzählt vom ewigen Kommen und Gehen, von der Suche nach Glück und Wohlstand, welche die Menschen immer irgendwohin treibt. Eine romantisierende Sichtweise wird diesem Motiv aber nicht gerecht.
Denn das Bild ist Teil einer umfassenden Reportage, mit der Andreas Seibert (*1970) während Jahren die Not der chinesischen Wanderarbeiter dokumentierte. Seibert, selbst lange mit seiner Familie in Asien ansässig, hat sie unter dem Titel «From Somewhere to Nowhere» als Buch und Ausstellung sowie in diversen Zeitungen und Magazinen veröffentlicht. Millionen von Arbeitskräften fahren vor allem zum chinesischen Neujahrsfest in ihre weit entfernte Heimat im Hinterland. Sie gehören zu den Schwächsten, am wenigsten Geschützen und sind zugleich der Treibstoff für den Motor der Globalisierung. Wo wird die Reise dieses Wanderarbeiters enden?
Das letzte Lichterfest

Roman Vishniac: «The Last Hanukkah», Krakau, 1938.
Eine Gruppe von Männern im Schneeregen: Die Aufnahme dieser düsteren Versammlung entstand 1938 im Judenviertel von Krakau. Roman Vishniac (1897–1990), ein Russe jüdischer Abstammung, war ein Pionier der Wissenschaftsfotografie und lebte damals in Berlin. Zwischen 1935 und 1939 reiste er im Auftrag einer jüdischen Hilfsorganisation mehrmals nach Osteuropa, wo es ihm, trotz Fotografieverbot, gelang, die elenden Lebensbedingungen der Juden in den Ghettos und Schtetl festzuhalten. Vishniacs winterliche Szene zeigt Altkleiderhändler und ihre Kunden. Der Titel der Fotografie bezieht sich auf eine Einladung zur Chanukka-Feier an der Hauswand.
Es war das letzte Mal, dass das Lichterfest in Kazimierz stattfand, dem jüdischen Wohnviertel von Krakau. Nach dem Überfall auf Polen 1939 bauten die Nationalsozialisten am Stadtrand ein mit Stacheldraht und Mauern umgebenes und von der SS bewachtes Ghetto. 15 000 Juden wurden auf einem Areal zusammengepfercht, wo vorher 3000 Menschen lebten. Die Bevölkerung des Krakauer Ghettos wurde 1942/43 in Arbeits- und Vernichtungslager deportiert, Hunderte von Geschwächten im Ghetto selbst erschossen. Vishniacs karge Fotografie scheint in ihrer bleiernen Tristesse das unfassbare Grauen anzudeuten: schutzlose Menschen in Nässe und Kälte vor einer abweisenden Fassade und einer geschlossenen Tür.
Pailletten und Patina

Flurina Rothenberger: aus der Serie «Dakar ne dort pas. Dakar se noie», 2012/13.
Eine paillettenbesetzte Kopfbedeckung, ein aufwendig geschneidertes Kleid aus glänzendem Stoff, Rüschen und Ornamente – die Senegalesin, die in aufrechter Haltung durch eine leere Strasse geht, strahlt die Eleganz und Aura eines Models auf dem Laufsteg aus. Fotogen ist auch die desolate Umgebung: das Autowrack im Hintergrund, die Patina der Wände und die Spiegelungen auf dem überschwemmten Boden. Doch wie ist es für die junge Frau, in einer vom Wasser erodierten Welt zu leben? Das Bild ist Teil der Fotoserie «Dakar ne dort pas. Dakar se noie» von Flurina Rothenberger (* 1977). Überschwemmungsgebiete an den Randzonen Dakars werden seit den 1970er Jahren wild besiedelt, Urbanisierungskonzepte fehlen, und der Alltag ist besonders während der Regenzeit geprägt von den Folgen der Fluten, der Überpopulation und der fehlenden Infrastruktur.
Auch wenn ein einzelnes Bild die komplexen Zusammenhänge nicht vermitteln kann, so wird hier ein wichtiger Aspekt im Umgang mit der Problematik visualisiert: Widerstandskraft. Trotz den Missständen geht die junge Muslimin mit Haltung durch die vom Zerfall gezeichnete Welt. Dieser Kontrast fasziniert, und wir haben den Eindruck, dass die Fotografin eine ausserordentlich festlich gekleidete Frau für ihre dokumentarische Arbeit auswählte. Zugleich irritiert uns das Bild, weil die uns bekannten modischen Codes beim Lesen nicht greifen.
Doppeltes Make-up

Hans Peter Klauser: Ausflecken eines Werbebildes für den Hauptbahnhof Zürich, um 1960.
Eine Fotografie von der Herstellung einer Fotografie legt die Künstlichkeit der uns umgebenden Bilderwelt offen: Auf dem mittleren Streifen eines riesigen Frauenkopfes, der am Zürcher Hauptbahnhof Nescafé anpreisen soll, kauern, ja liegen zwei Fleissige und retuschieren mit feinen Pinseltupfern Störendes – im Gesicht und auf der Fotografie. Hans Peter Klauser (1910–1989) hielt dieses doppelte Make-up in seinem eigenen Atelier an der Stadelhoferstrasse 26 in Zürich fest. Hier fertigte er von 1957 bis 1989 Grossvergrösserungen für Werbekunden und machte sich dank seinem technischen Flair einen Namen auf diesem Gebiet. Dabei hätte sich Klauser eigentlich lieber der Reportage gewidmet – dem karg bezahlten Metier, das er bei seinem Lehrmeister Gotthard Schuh gelernt und in den Jahren vor und nach dem Zweiten Weltkrieg leidenschaftlich ausgeübt hatte.
Die Beobachtung von Menschen faszinierte ihn: Sein volkskundliches Buch über das Appenzellerland enthält ebenso eindrückliche Bilder wie seine Magazinbeiträge über Flüchtlingskinder. Doch sogar einem Werbeauftrag rang er noch diese Momentaufnahme ab: Bevor die Frau am Boden zu einer überdimensionierten Maske in der Bahnhofhalle erstarrte, machte der Fotograf das offene Auge und die Feinarbeit zum Thema – eine Aufforderung, genau hinzuschauen, um im Alltäglichen das Eigenartige zu entdecken.
Vom ersten zum zweiten Blick

Doris Quarella: aus der Serie «Urner Bildnisse», 1979.
Der erste Blick ist entscheidend. Wir versuchen das Gegenüber einzuordnen – nach Herkunft, Alter, sozialer Stellung, Beruf oder Ausstrahlung. Das gilt auch bei fotografischen Porträts. Aber was, wenn die Anhaltspunkte für eine Einordnung auf ein Minimum reduziert sind? In ihren «Urner Bildnissen» hat Doris Quarella (1944–1998) die abgebildeten Menschen bewusst «entwurzelt », aus ihrem alltäglichen Kontext herausgelöst. Zwischen März und Mai 1979 lud sie 208 Personen aus dem Kanton Uri, ausgewählt aufgrund statistischer Daten, in ihr improvisiertes Studio im Saal der Hostellerie «Sternen» in Flüelen ein.
Für die Aufnahme vor neutralem Hintergrund mussten die Fotografierten eine Haltung einnehmen, ohne sich auf biografische oder berufliche Requisiten oder auf ihre vertraute Umgebung abstützen zu können. Gesichtsausdruck, Hände und Kleidung rücken ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Was verraten das verschmitzte Lächeln, die dunkel umrandeten Fingernägel, der Wollpullover über Ambros Lussmann? Was sagt der offene, direkte Blick von Franziska Epp über ihr Wesen und ihr Leben? Quarella präsentierte die Bergbäuerin und den Holzarbeiter und viele andere mit der Bezeichnung ihrer Tätigkeit, aber in ihren Bildern begegnen uns keine auf den ersten Blick kategorisierbare Typen, sondern einzigartige Persönlichkeiten.
Spazierfahrt mit Puppe

Hugo Jaeggi: Paris, 1961.
Ein Mädchen auf Rollschuhen, in der Hand einen Puppenkorb. Was bei anderen Fotografen ein liebliches Bildmotiv wäre, wirkt bei Hugo Jaeggi (1936 bis 2018)fremd und beunruhigend.Durch die ungewöhnliche Perspektive bleibt der Oberkörper des Mädchens ausgespart, stattdessen liegt der Fokus der Kamera auf den Beinen und Füssen. Die Aufnahme lebt von den Details: das kranzartige Haar der Puppe; das waffenähnliche Holzstück in der Kinderhand; die Füsse, die in zu kleinen Schuhen zu stecken scheinen; der mit herbstlichem Laub übersäte Boden;derschiefe Horizont,der die Standfestigkeit des Kindes gefährdet – wobei die Sinnlichkeit der Details von magischer Kraft ist.
Jaeggi vermochte es, Menschen und Gegenstände durch die Auswahl des Bildausschnitts und das Abdrücken im richtigen Moment so festzuhalten, dass sie dem Alltäglichen entrückt wirken. Jedes Bild ist eine sorgfältige Komposition. Seine Fotografien öffnen einen Bedeutungsraum jenseits des Sichtbaren und laden zum Assoziieren ein. Darin spiegelt sich auch Jaeggis künstlerische Haltung: Für ihn war die Fotografie ein Ausdrucksmittel für seine innere Gefühls-,Gedanken- undTraumwelt.Was Jaeggi in seinen späteren Arbeiten zuweilen beinahe plakativ auf die Spitze trieb, zeigt sich in Ansätzen schon in seinen frühen Aufnahmen. Scheint das Rollschuhmädchen einen nicht in ein unheimliches Phantasiereich entführen zu wollen?
Pausenbrot

Hans Staub: Pause der Bauarbeiter, um 1930.
Drei junge Männer kauern eng beisammen: Bauarbeiter, die im Schatten Pause machen. Einer liest Zeitung, die anderen lesen mit – oder schweift ihr Blick zur Passantin auf der anderen Strassenseite? Dies jedenfalls suggeriert der Bildausschnitt: Durch die begrenzte Tiefenschärfe der Fotografie bleibt die Frau zwar nur eine verschwommene Andeutung, dennoch gibt ihr das helle Sonnenlicht eine rätselhafte Präsenz. Als diese Momentaufnahme entstand, berichtete die Presse von der Weltwirtschaftskrise, die 1929 einsetzte, aber erst in den folgenden Jahren die Schweiz erfasste und viele in die Arbeitslosigkeit stürzte. Der sensible Beobachter der Szene, Hans Staub (1894–1990), hatte sich zunächst als Bildhauer versucht, dann als Heliograf und Leiter der Hausdruckerei von Escher Wyss gearbeitet, bevor er 1930 Fotoreporter wurde.
Sein grosses Thema war das Leben und die Arbeitswelt der kleinen Leute. Staubs Fotoarbeiten erschienen vor allem in der legendären «Zürcher Illustrierten», die 1941 eingestellt wurde. Damit verlor er nicht nur seinen wichtigsten Auftraggeber, sondern auch einen prominenten Platz als Chronist des Alltags. In hohem Alter durfte er erleben, wie das Interesse an seinem Werk wiedererwachte. Mit untrüglichem Gespür hatte er unscheinbare, aber aufschlussreiche Situationen im Alltag erkannt – und Stimmungen fotografiert, in denen uns die Vergangenheit nahe kommt.
Konstruierte Unbefangenheit

Ruth Erdt: Pablo und Eva, 1998, aus «The Gang».
Wer das fotografische Werk von Ruth Erdt kennt, meint sie und ihre Familie persönlich zu kennen. Die beiden sommersprossigen Protagonisten vor der Spiegelwand sind ihre Kinder: Pablo und Eva begegnen uns auf unzähligen Bildern, so auch der Partner, die Freunde und Freundinnen der 1965 geborenen Fotografin. Sie bilden «The Gang», wie sie 2001 ihre erste monografische Publikation betitelte. Diese Abfolge von Porträts, Selbstdarstellungen und Stillleben wirkt wie ein intimes Tagebuch, verrät aber bei näherer Betrachtung ein raffiniertes Spiel mit kleinen Inszenierungen. Pablos Blick fixiert im Spiegel das auf ihn gerichtete Fotoobjektiv.
Er beteiligt sich an der Konstruktion einer Momentaufnahme, ist Komplize, aber er kann die Brechungen und Täuschungen nicht sehen, die letztlich den Reiz der Aufnahme ausmachen. Eva scheint mit dem Kamm durch sein Haar zu fahren, während sie in Wirklichkeit Abstand wahrt und in der Bewegung innehält. Die Szene berührt, weil sie Nähe und Distanz zugleich vermittelt, weil sie Unbefangenheit vortäuscht und auf die Subjektivität derWahrnehmung verweist – und weil sie uns an die eigene Jugend oder die Jugend unserer Kinder denken lässt.Was zurückbleibt,sind Bruchteile einer verlorenen Gegenwart, gespiegelt und verzerrt im Kaleidoskop der Erinnerungen.
Die Kunst und das Leben

Karl Geiser: Maria Vanz steht Modell im Atelier Zollikon, um 1933.
Karl Geiser gehört zu den wichtigsten Schweizer Bildhauern des 20. Jahrhunderts. Weniger bekannt als sei- ne Skulpturen sind seine Fotografien. Zwar strebte er nie eine fotografische Karriere an; doch die Aufnahmen, die er auf Reisen oder im Atelier schuf, sind beeindruckende Zeugnisse einer künstlerischen Vision und können als eigenständige Werke bestehen. Das gilt auch für die um 1932 entstandene Fotografie von Maria Vanz, Geisers Modell für seine Arbeit an der Berner «Mädchengruppe». Besonders im Atelier geschah es oft, dass der Bildhauer seine Figuren mit der Kamera obsessiv umkreiste und umwarb; wie ein Verliebter gab er sich einem Bilderrausch hin. So stellte er eine intensive Beziehung zu seinen Modellen her, als wollte er sie vor der definitiven Erstarrung bewahren.
Mit seiner spontanen, technisch unbekümmerten und ungemein sinnlichen Art des Fotografierens betonte er in diesem Fall auch das Fragmentarische und Provisorische der entstehenden Figurengruppe. Noch sind Phantasie und Wirklichkeit im Widerstreit – die Skulptur überragt das Modell wie ein bedrohlicher Schatten. Geisers Atelier war nicht nur das Zentrum seines Liebens und Lebens; es war auch der unheimliche Ort, in dem seine Kreationen zuweilen über ihn hinauswuchsen.
Die Wiederkehr des Verdrängten

Jean-Luc Cramatte: aus der Serie «Culs de ferme», 2016.
Der Kamin steht windschief, die Bretter lösen sich aus den Fugen, und aus der bröckelnden Fassade drängendes Gestrüpp verrät, dass sich niemand mehr um diesen Teil des Bauernhofs kümmert. Zwar wurde der Betrieb noch nicht aufgegeben – die mit Mist gefüllte Karre und eingeschweisste Heuballen im Hintergrund zeugen davon. Aber die Symptome einer prekären Existenz sind unübersehbar. Die Aufnahme des 1959 in Porrentruy geborenen Fotografen Jean-Luc Cramatte gehört zur umfangreichen Serie «Culs de ferme», einer Arbeit über die meist etwas versteckten Hinterseiten von Höfen und Ställen: Unorte, an denen Fässer und Kisten, kaputte Gestelle und Maschinenteile, rostige Ketten und Werkzeuge, häufig auch noch ein desolater Wohnwagen oder ein trauriges Töffli deponiert wurden. Cramatte ging es aber nicht darum, das Ende des Bauernstands zu dokumentieren.
Ohne Kritik und ohne demonstrative Absicht, ohne Orts- und Zeitangabe erstellte er ein umfangreiches Inventar der bäuerlichen Restposten, das er 2016 auch als Künstlerbuch herausgab – fasziniert von der Poesie des Akkumulierens. Es wirkt wie ein Blick ins kollektive Unbewusste, ein Gegenstück zu all den idyllischen Bildern, mit denen wir die bäuerliche Welt gerne verklären. Eine Metapher für all jene Bereiche unseres Lebens, die wir lieber ausblenden. Allein, das Verdrängte holt uns immer wieder ein.
Riss im Bild

René Burri: Bahnhof, Frankfurt am Main, um 1960.
1962 publizierte René Burri seinen grossen Foto-Essay «Die Deutschen», worin er das damalige soziale und politische Klima in Deutschland eindrucksvoll in Bilder fasste. Er war bereits 1959, erst 26-jährig, in die berühmte Agentur Magnum aufgenommen worden, deren Mitglieder sich an Vorbildern wie Henri Cartier-Bresson orientierten: Ein guter Fotograf, so Cartier-Bresson, sollte wie ein Jäger auf den «entscheidenden Augenblick» einer Handlung lauern. Burris Bild vom Frankfurter Bahnhof, das es aufs Cover seines Buchs schaffte, zeigt jedoch, dass der Schweizer solche Dogmen gern aufs Korn nahm.
Zwar zollte ihm Cartier-Bresson durchaus Anerkennung für diese Fotografie, die er offenbar für einen entscheidenden Augenblick hielt: Ein eigenartiger Bruch durchzieht das Bild und trennt die Menschen – eine disruptive Störung, würde man heute vielleicht sagen. Dabei freute sich Burri noch Jahre später über seinen Streich. Denn die Frau auf der linken Seite gehört zu einer vorhergehenden Aufnahme; auf dem Negativstreifen lag sie so perfekt neben dem folgenden Bild, dass sich daraus eine spannende, fast filmische Szene ergab. Also doch kein entscheidender Augenblick – aber ein Meisterwerk, das über die Isolation von Menschen, die Suche nach Orientierung und die tiefen Risse in der Gesellschaft der Nachkriegszeit nachzudenken anregt.
Absurdes Ballett

Gotthard Schuh: «Zöglinge bei Perugia», 1929.
«Ich bin mir bewusst, dass meine frühen Photographien den heutigen Betrachter nicht mehr überraschen. Ihr Inhalt und ihre Form sind uns mit der Zeit selbstverständlich geworden. Aber als sie entstanden, waren sie in beidem revolutionär», schrieb Gotthard Schuh (1897–1969) über sein Frühwerk. Er bezog sich auf Bilder wie «Zöglinge bei Perugia» von 1929. Noch bevor sich Schuh dem Fotojournalismus zuwandte, entdeckt er um diese Zeit, von der Malerei her kommend, die Fotografie als Ausdrucksmittel. Sein Interesse galt einer klaren, unpathetischen Bildsprache und der Möglichkeit, auch alltägliche Situationen in eine aufregende visuelle Erfahrung zu übersetzen.
Mit der Kamera konnte Schuh etwa diejenigen Zufälle des Lebens erfassen, die dem menschlichen Auge sonst verborgen bleiben. Oder Konstellationen sichtbar machen, welche die Welt in ein absurdes Ballett verwandeln. Bei den spielenden Zöglingen geht es nicht so sehr um einen konkreten Ort oder das Dokument einer bestimmten Zeit. Es sind die simultanen Gesten und Haltungen, das spannungsvolle Nebeneinander der verschiedenen Figuren und Bewegungen, die den Reiz der Fotografie ausmachen. Die formale Kraft des intuitiv erhaschten Augenblicks konnte Gotthard Schuh aber erst bewusst werden, als er die Aufnahme in der Dunkelkammer entwickelte und vergrösserte.
Der wandernde Blick

«Paysages de femme» – eine Transformation der weiblichen Anatomie in eine freie, skulpturale Formensprache.
René Mächler (1936–2008) ist vor allem als Vertreter der sogenannten konkreten Fotografie bekannt: Ende der 1960er Jahre begann er an ungegenständlichen Kompositionen zu arbeiten, indem er mit Licht abstrakte Formen und Muster aufs empfindliche Papier brachte. Die Arbeit «Paysage de femme» kündigt diese Abkehr von der dokumentarischen Fotografie schon an. Von 1960 bis 1996 arbeitete Mächler als Wissenschaftsfotograf am Institut für Rechtsmedizin der Universität Basel und setzte sich dabei intensiv mit dem menschlichen Körper auseinander. «Paysage de femme» kann als Reaktion darauf verstanden werden – eine Transformation der weiblichen Anatomie in eine freie, skulpturale Formensprache. Mächlers Arbeit wurde 1964 unter dem Titel «Paesaggi di donna» in Italien publiziert; sie steht auch für einen neuen Ansatz in der Aktfotografie.
Trotz der modernen objekthaften Verfremdung bleiben die Darstellungen überaus sinnlich. In engen, präzis gewählten Ausschnitten tastet Mächler Wölbungen und Einbuchtungen ab, deren Oberfläche sich je nach Beleuchtung glatt und weiss vor dem schwarzen Hintergrund präsentiert oder eine Struktur aus Poren und Härchen, Falten und Höhlen offenlegt. Mit der Fragmentierung und den übersteigerten Kontrasten wird die anatomische Ausgangslage verschleiert. Der Blick wandert «über Hügel, Berge, Ebenen», wie es im suggestiven Text zu «Paesaggi di donna» heisst.
Zeigen und verbergen

Henriette Grindat: Times Square, New York, 1968.
Die Aufnahme von Henriette Grindat erschliesst sich nicht auf den ersten Blick. Da ist eine junge, fast nackte Frau, die den Betrachter mit halb geöffnetem Mund fixiert und gespielt überrascht ihre Brüste abdeckt. Da ist eine ältere, bekleidete Frau, die ihr Gesicht hinter den Sprechschlitzen der Kasse versteckt. Beide Figuren sind gefangen zwischen Rahmen, Fenstern und Spiegelungen. Die Fotografin hat diese verwirrende Situation in einer Groteske erfasst: In der Überlagerung von Vorder- und Hintergründen entsteht ein absurdes Nebeneinander von Gesten des Zeigens und Verbergens, von gegensätzlichen weiblichen Rollenmustern, die dem Voyeur begegnen. Denn Grindat steht am Eingang zu einem jener Etablissements, die sich in den sechziger Jahren in der Gegend um den New Yorker Times Square breitmachten: Pornokinos, Peepshows, Go-go-Bars, Sexshops.
Am unteren Bildrand ein Drehkreuz, das der Kunde passiert, nachdem er bezahlt hat. Dahinter ein Treppengeländer, das hinabführt zu schäbigen Vergnügungen im Untergeschoss. Bereits in den 1950er Jahren hatte sich die in Lausanne lebende Fotografin, einem der Kinderlähmung geschuldeten Hinken trotzend, dem Reisen und Entdecken neuer Welten verschrieben. In der Momentaufnahme vom Times Square scheint der Einfluss des Surrealismus nachzuklingen, mit dem sich Grindat in den vierziger Jahren in Paris auseinandergesetzt hatte.
Die Ungewissheit danach

Dominic Nahr: Japan, Namie, 2012. Ein Jahr nach dem Tsunami sucht die Polizei nach den sterblichen Überresten vermisster Personen in der nuklearen Sperrzone in Fukushima.
Eine Sperre aus zerklüfteten Betonelementen, die den Blick auf die Landschaft verwehren; ein bleischwerer Himmel, Menschen in weissen Schutzanzügen und leuchtend roten Westen. Alles auf diesem Bild deutet auf einen Ausnahmezustand hin, eine Katastrophe, einen GAU. Kennen wir dieses Szenario nicht aus Hollywood? Erst bei genauerem Hinsehen nehmen wir mit Staunen die einfachen Instrumente wahr, die die gesichtslosen Vermummten mit sich führen. Mit Stäben stochern sie in den Betonelementen, die wie die Spielwürfel eines Riesen das Bild beherrschen.
Was sie tun, erschliesst sich erst im Gespräch mit dem Schweizer Fotografen Dominic Nahr, der die unheimliche Szene 2012 bei Namie, einer Kleinstadt in der Präfektur Fukushima, festgehalten hat. Der Küstenort neben dem Reaktorkomplex Daiichi wurde am 11. März 2011 schwer getroffen von Erdbeben, Tsunami und Verstrahlung. Zu sehen sind Polizeikräfte, die nach Vermissten suchen – ein Jahr nach dem Tsunami. Wie quälend die lange Ungewissheit für die Hinterbliebenen gewesen sein muss, können wir uns kaum vorstellen. Nahr dokumentierte die Folgen des Unglücks so umfassend wie kein anderer Fotograf. Er arbeitete überdies mit einer 360-Grad-Videokamera, die den Betrachter mitten in die Sperrzone versetzt. Die Produktion feierte kürzlich am Sundance Film Festival Premiere.
Vorbeiziehende Landschaften

Simone Kappeler: Auf einer Autoreise quer durch die USA entdeckt Simone Kappeler 1981 den Reiz von Plastikkameras.
Das Bild könnte einem Roadmovie entstammen, in dem coole Autos, vorbeiziehende Landschaften und laute Musik eine zentrale Rolle spielen. Goldenes Licht fällt auf den Nacken und die wehenden Haare der jungen Frau auf dem Beifahrersitz, während die Person am Steuer unsichtbar bleibt; nur ihre Hand, eine Zigarette haltend, ragt ins Bild. Draussen die brutalen Betonbauten einer Grossstadt, Über- und Unterführungen für die freie Fahrt. Drinnen die Intimität eines geschützten Raums.
Die von Simone Kappeler aufgenommene Szene verheisst Freiheit, Abenteuer und Aufbruch in eine unbekannte Zukunft. Sie ist ein Schlüsselbild aus der umfangreichen Serie «America 1981», in der die frisch ausgebildete Fotografin zu einer neuen, persönlichen Bildsprache fand. Während einer monatelangen Autoreise von New York nach Los Angeles entdeckte sie den Reiz des flüchtigen Fotografierens mit billigen Plastikkameras. Diese erlaubten ihr ein freches Spiel mit zufälligen Ausschnitten und Unschärfen, verwaschenen Farben und unkontrollierten Belichtungen. Kappelers visuelles Tagebuch widerspiegelt aber auch ihre Befreiung des Sehens: «Ich wollte nur aufnehmen, was mich berührt, und in weichen oder harten Tönen und subjektiven Farben meinen Empfindungen Ausdruck verleihen. Es sollte auch eine Reise zu mir selbst werden.»
Botschaft im Doppel


Barbara Davatz: Serge und Carole, 1982/2014, aus der Serie «As Time Goes By».
1982 fotografierte Barbara Davatz (*1944) in Zürich zwölf Paare, die durch ihr ausdrucksstarkes Äusseres auffallen. Im Doppelporträt sind die Codes, die über Kleidung, Haltung und Mimik ausgesendet werden, verstärkt und zugleich variiert. Sie drücken sowohl Individualität wie Gruppenzugehörigkeit aus. Davatz porträtierte dieselben Personen erneut 1988, 1997 und zuletzt 2014. Meistens veränderte sich die Partnerkonstellation. Serge und Carole sind eine Ausnahme. Ihre Beziehung blieb konstant, auch wenn unklar ist, ob es sich um eine Freundschaft oder eine Liebesbeziehung handelt.
Der einst androgyne Serge, der in den 1980er Jahren eine neue, etwas zu grosse Bikerjacke trug, wurde zum Mann – sein Kleidungsstil dezenter, das Rebellische im Blick verschwand. Carole machte eine ähnliche Metamorphose durch. Der Fluss der Zeit ist ablesbar an der äusseren Hülle der Porträtierten, nicht aber an einer veränderten Ästhetik der Fotografie. Dies erscheint zunächst banal, macht aber die Qualität der Arbeit aus: Komposition, Lichtführung und Kontrast der analogen Schwarz-Weiss-Fotografie haben dem fortschreitenden technologischen Wandel getrotzt. Nur so ist es uns möglich, die beiden 32 Jahre auseinanderliegenden Bilder zu vergleichen, als wären sie wissenschaftliche Zeichnungen der Gattung Mensch.
Vielsagende Blicke

Pia Zanetti: Fussball-Zuschauer in der Township Soweto am Stadtrand von Johannesburg, 1968
Nach dem Abschluss ihrer Ausbildung in Basel arbeitete Pia Zanetti (*1943) in Rom und London als freischaffende Fotografin. 1971 kehrte sie in die Schweiz zurück, von wo aus sie ihr Engagement für diverse Zeitschriften fortsetzte, unter anderem für die NZZ Wochenendbeilage, Du, Die Woche und Das Magazin vom Tagesanzeiger. Pia Zanetti gehört zu den profiliertesten Schweizer Fotojournalistinnen ihrer Generation. Viele Reportagen über soziale und politische Themen realisierte sie mit ihrem Mann, dem Journalisten Gerardo Zanetti.
Diese Aufnahme einer Menschenmenge entstand 1968 im Rahmen eines Berichts über die Apartheid in Südafrika. Zu sehen ist eine Zuschauertribüne in der Township Soweto am Stadtrand von Johannesburg: Ein Nebeneinander von jungen schwarzen Männern, die konzentriert und grösstenteils amüsiert ein Fussballspiel verfolgen. Aus ihren Blicken sprechen unterschiedliche Emotionen – Erwartung, Freude, jedoch auch Sorge – als fixierten sie nicht nur das Geschehen auf einem Spielfeld. Das unscharfe Gesicht im Vordergrund des Bildes verleiht der Szene etwas Verstörendes und Beunruhigendes. Wie eine Maske, wie das in die friedliche Situation hineinmontierte Phantom eines Gejagten spiegelt dieses Antlitz eine angespannte Wachsamkeit, welche an die Schikanen eines durch Rassismus geprägten Alltagslebens denken lässt.
Die Entdeckung der Langsamkeit

Guido Baselgia: Tierra templada № 1, 2018, Sammlung Förderverein der Fotostiftung Schweiz.
Eine irritierende Kulisse, vor der man leicht den Boden unter den Füssen verliert: Surreal zeichnen sich die Silhouetten der Bäume vor einem Dunstschleier ab. Von Farnen, Schlingpflanzen und Orchideen überwuchert, erinnern sie an urtümliche Wesen mit struppigen Fellen und Bärten. Die Aufnahme von Guido Baselgia (*1953) ist Teil seines neuesten Werkzyklus, der 2018 und 2019 in Ecuador und Peru entstand. Nach jahrelanger, intensiver Auseinandersetzung mit kargen und leeren Landschaften – sei es im Engadin, im Norden Norwegens oder in den Anden – stellte sich der Künstler der Fülle: Ausgerüstet mit einer Grossformatkamera suchte er im undurchdringlichen Dickicht des Regenwaldes nach den Formen, Strukturen und Lichtstimmungen, die diesen Lebensraum prägen.
Baselgia, der sich nicht zuletzt als Architekturfotograf einen Namen gemacht hat, tauchte in eine Welt ein, die ihren eigenen Gesetzen gehorcht. Hier sucht man vergeblich nach Übersicht: Was ist oben, was unten? Wie nah oder wie fern ist das Blätterwerk, das sich im Nebel verliert? Der Verlust der gewohnten Orientierung zwang den Fotografen zur Langsamkeit – und schärfte seine Sinne für eine wundersame Wildnis, deren Zerstörung unaufhaltsam voranschreitet.
Licht und Schatten

Barnabás Bosshart: Faustina Leitão Amorim, Alcântara, 1986.
Der Blick von Faustina Leitão Amorim scheint durch den Betrachter hindurch zu gehen. Das faltige Gesicht wirkt müde, vom Leben und vom Alter gezeichnet. «Sie war halb blind und hörte kaum noch etwas», sagt der Schweizer Fotograf Barnabás Bosshart (*1947) über die Frau, der man den harten Überlebenskampf in Maranhão, einem der ärmsten Staaten Brasiliens, ansieht. Es ist anzunehmen, dass sie wie die meisten Bewohner der ehemaligen portugiesischen Kolonialstadt Alcântara von afrikanischen Sklaven abstammt. Barnabás Bosshart war auf seiner Lateinamerikareise im Jahr 1973 das erste Mal in dem vergessenen Kaff im Nordosten von Brasilien vorbeigekommen und hatte sich in die Gegend – seine spätere Wahlheimat – verliebt. Bald darauf verabschiedete er sich von der glamourösen Modefotografie, in der er eine vielversprechende Karriere gestartet hatte.
Ab 1980 besuchte er Alcântara einmal jährlich und begann, den Ort und seine Bewohner mit der Kamera zu porträtieren. Entstanden sind stimmungsvolle Landschaftsaufnahmen und sensible Porträts, die sich durch eine nüchterne und zugleich ästhetische Bildsprache auszeichnen. Bossharts Fotografien leben von starken Kontrasten und tiefen Schwarztönen, welche die hellen Bildpartien zum Leuchten bringen. So scheint auch das Porträt Faustina Leitão Amorims ganz aus Licht und Schatten geformt – eine Lichtzeichnung im wahrsten Sinne des Wortes.
Pfauensprung

Lukas Felzmann: Aus der Serie «Waters in Between», 2008.
«Interessante Bilder», sagt Lukas Felzmann, «fallen mir nicht einfach in einem beliebigen Moment zu. Voraussetzung dafür ist eine Art erweitertes Bewusstsein und eine spezielle Aufnahmefähigkeit. Es ist ein Prozess, bei dem man zwischen Intuition und Reflexion hin- und herpendelt.» Felzmann, 1959 in Zürich geboren, lebt seit 40 Jahren in Kalifornien. In unzähligen Streifzügen hat er sich mit dem Central Valley, dem 600 km langen und 80 km breiten kalifornischen Längstal auseinandergesetzt, das zu den fruchtbarsten Gegenden der Erde gehört.
Dem Fotografen geht es bei seiner Arbeit nicht so sehr um eine wissenschaftliche Dokumentation als um ein langsames, intuitives Erkunden des Zusammenspiels von Natur und Zivilisation. Er sucht nach sichtbaren Verbindungen zwischen Geschichte und Gegenwart, zwischen den kleinsten Phänomenen und den grössten Kräften des Universums. Sein 2009 erschienenes Buch Waters in Between ist eine Art visuelle Meditation, in der eigentlich alles Platz hat – auch ein Pfau, der über das Dach eines schäbigen Hauses zu schweben scheint. Die in die Ferne gerichteten Antennen stehen in hartem Kontrast zur grazilen Silhouette des hüpfenden Vogels. Ein absurder Moment, scheinbar zufällig erhascht, öffnet die Augen für das Nahe und Flüchtige.
Mode in Bewegung

Peter Knapp: Grace Coddington in Electric Fittings, für «Vogue», London, Juni 1971.
Schwungvollen Schrittes schiebt diese schrille Kreatur einen Kinderwagen auf ein farbloses Grüppchen zu: Nannys, die in Schürzen und Hauben ihre Schützlinge durch den Hyde Park stossen. Die feuerrote Mähne gehört Grace Coddington, damals bereits Bildredaktorin der «British Vogue» Weil dem Fotografen Peter Knapp die Beine des vorgesehenen Models nicht lang genug waren, liess sich das Ex-Model spontan vor die Kamera bitten. Sie wählte das Outfit von Electric Fittings, und Knapp inszenierte die skurrile Situation, die im Juni 1971 in der «British Vogue» erschien. Der 1931 in Bäretswil geborene Peter Knapp war nach seiner Ausbildung zum Grafiker an der Züricher Kunstgewerbeschule für ein Kunststudium nach Paris gegangen und hatte sich dort einen Namen als Modefotograf gemacht.
Als künstlerischer Leiter prägte er in den 1960er und 1970er Jahren das Erscheinungsbild von «Elle». Knapp erkannte die Zukunft der Prêt-à-porter-Kollektionen, er brachte die Mode auf die Strasse – und in Bewegung. Die Dynamik seiner eigenen fotografischen Kompositionen übersetzte er auch in das Layout der Zeitschrift. Neben dem Erfolg in der Modewelt widmete sich Peter Knapp seinen freieren, konzeptuelleren Arbeiten. Die Fotostiftung durfte 2018 einen substanziellen Bestand dieses bedeutenden Schweizer Fotografen in die Sammlung aufnehmen.
Der intime Raum

René Groebli: Aus: «Das Auge der Liebe», 1952.
René Groeblis zweites Fotobuch «Das Auge der Liebe», 1954 erschienen, fand in der konservativen Schweiz der 1950er Jahre wenig Anklang, doch inzwischen ist es aus der Fotografiegeschichte nicht mehr wegzudenken. Der Bildband liest sich wie eine poetische Liebeserklärung an seine Frau Rita. Die Aufnahmen, auf der Hochzeitsreise in Frankreich entstanden, scheinen einen Tag im Leben der Frischvermählten einzufangen. Nur selten wird der intime Raum des Hotelzimmers verlassen. Stattdessen verweilt das Auge der Kamera auf der Geliebten oder auf den Spuren einer gemeinsam verbrachten Nacht.
Der Fotograf und Ehemann bleibt – mit wenigen Ausnahmen – unsichtbar. Dennoch führt er immer Regie: durch seinen Blick, der den weiblichen Körper nicht ausstellt, sondern spielerisch mit der Kamera umkreist. Rita zeigt sich als Silhouette im Gegenlicht, taucht aus dem Zwielicht des Hotelzimmers auf oder verbirgt sich in der leichten Bewegungsunschärfe der Aufnahmen. In die Intimität und Sinnlichkeit mischt sich eine sanfte Melancholie. Der erotische Unterton wie auch die radikale Subjektivität der Fotografie machen «Das Auge der Liebe» zu einem herausragenden Werk, mit dem Groebli im Bereich der Bildererzählungen neue Massstäbe setzte.
Berliner Schraffur
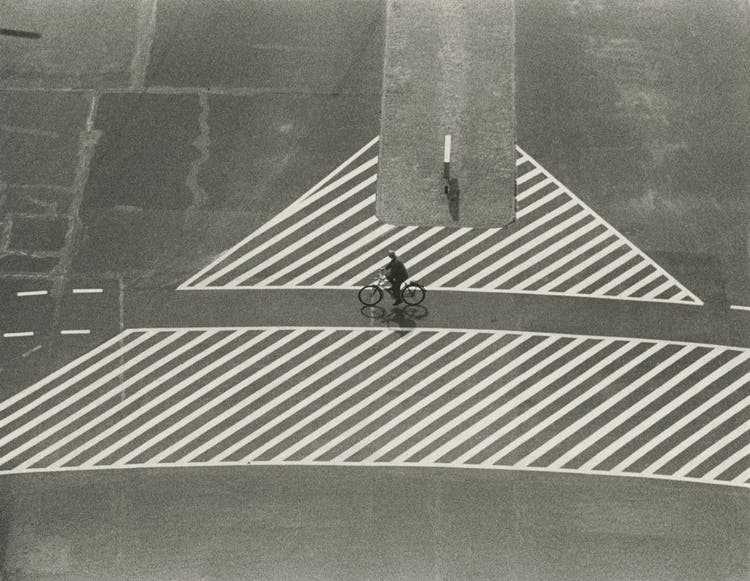
Rudolf Lichtsteiner: Berlin, 1961.
Ein Fahrrad durchquert die Sperrfläche auf dem dafür vorgesehenen Radweg. Würde es fehlen, so hätte man Mühe, die Fläche als Strassenkreuzung zu erkennen und ihre Grössenverhältnisse einzuschätzen. So aber gibt der Radfahrer mit seinem Schatten dem Bild eine Tiefe: Die zweidimensionale Schraffur wird zum urbanen Raum.
Die Aufnahme stammt aus einer frühen Berliner Reportage von Rudolf Lichtsteiner. Mit der Erschaffung eigener Bildwelten hat sich der 1938 in Winterthur geborene Autodidakt schon zu Beginn der 1960er Jahre von der dokumentarischen Fotografie verabschiedet. Lichtsteiners Fotografie verweist aber auch auf sein späteres Schaffen: Der Radfahrer scheint der realen Welt durch die Wahl von Ausschnitt und Perspektive enthoben. Hinzu kommt der Zufall, der diesen stillen, surrealen Moment mitverantwortet. In späteren Werken setzt Rudolf Lichtsteiner Mehrfachbelichtungen oder Fotogramme, also experimentelle Spielarten der Fotografie, ein, um unsere Sehgewohnheiten herauszufordern.
Die Wirkung des Bildes beruht auf der starken formalen Komposition; sie funktioniert losgelöst von kontextuellen Informationen zur abgebildeten Person, zum Aufnahmeort oder zum Datum. Weiss man aber, dass sie nur wenige Wochen vor dem Bau der Mauer entstanden ist, kommt man in Versuchung, sie auch als Sinnbild für die geteilte Stadt zu lesen.
Zeigen und Verbergen

Manon: Aus der Serie «La dame au crâne rasé», 1978.
Mitte der 1970er Jahre gab sich eine junge Künstlerin den programmatischen Namen «Manon». Sie mischte mit ihren Auftritten als Femme fatale, mit provokanten Performances und Installationen die Zürcher Kunstszene auf, stellte Männer in einem Schaufenster aus oder präsentierte ihr von erotischem Dekor überbordendes Schlafzimmer als «Lachsfarbenes Boudoir» in einer Galerie.
Während ihrer Pariser Jahre konzentrierte sich Manon auf die fotografische Selbstinszenierung. Das vorliegende Bild aus der Serie «La dame au crâne rasé» kombiniert zwei Aufnahmen, die ineinander überzugehen scheinen. Ein nackter Rücken schält sich aus der Dunkelheit heraus – oder flieht dieses androgyne Phantom vor dem Licht? Der geschorene Kopf betont das Skulpturale der Erscheinung; das Gesicht ist zur Seite gewandt, doch verfremdet durch eine hell reflektierende Maske. Hier ringen Licht und Schatten miteinander: Zeigen und Verbergen. Über der angefügten Kulisse düsterer Grossstadtdächer verfängt sich der Blick an einer Wolke, der es nicht gelingt, die Sonne zu verdecken.
Bis heute setzt sich Manon in ihren Arbeiten – immer wieder auch Selbstdarstellungen – mit der Schönheit und mit der Vergänglichkeit auseinander. Anlässlich ihres achtzigsten Geburtstags 2020 wird die Künstlerin mit Ausstellungen in Zofingen, Paris und Winterthur gewürdigt.
In sich versunken
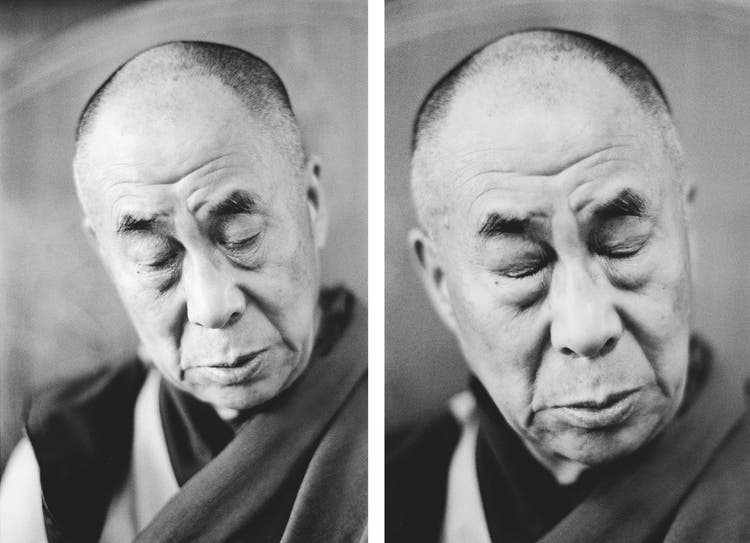
Manuel Bauer: Der Dalai Lama in Klausur, Dharamsala, 2004.
Wie viele Minuten mögen zwischen diesen beiden Porträts des 14. Dalai Lama liegen? Ist die Haltung des Kopfes noch dieselbe? Zeichnen sich auf den Augenlidern andere Fältchen ab? Beim Meditieren scheint die Zeit aufgehoben.Äusserlich sind an dem in sich versunkenen Menschen kaum Veränderungen festzustellen. Und doch reichte ihm die kurze Dauer vielleicht aus, um Berge zu versetzen.
Manuel Bauer, der 1966 geborene Schweizer Fotograf, dem diese Porträts zu verdanken sind, weiss Sichtbares und Unsichtbares miteinander zu verbinden. Als er sich am 16.August 2004 in Dharamsala dem geistigen Oberhaupt der Tibeter zuwandte, wollte er nicht äussere Merkmale festhalten, sondern die spirituelle Kraft spürbar machen, die vom Dalai Lama ausgeht. Die Darstellung höchster, ganz nach innen gerichteter Konzentration zeigt uns einen Mann, der zugleich an- und abwesend ist.
Diese intimen Bilder beruhen auf tiefem Vertrauen: Wie kaum ein anderer Fotograf hat Bauer Zugang zum engsten Zirkel um den Dalai Lama, dessen Freundschaft er sich durch jahrelanges Engagement für die Sache der Tibeter erworben hat. Nur so war es möglich, dass Seine Heiligkeit sich selbst in der privatesten Situation von ihm fotografieren liess.
Krieg ohne Krieg

Meinrad Schade: Beltring, Grafschaft Kent, England, aufgenommen 2009.
Ein friedlicher Himmel mit Schäfchenwolken hängt über einer rätselhaften Szenerie: Im Hintergrund stehen Panzer vor einem Armeezelt, vorne fährt ein bemannter Spielzeugpanzer frontal auf den Fotografen zu.Mit seiner pink verspiegelten Sonnenbrille strahlt der Fahrer eine Coolness aus, die peinlich wirkt. Meinrad Schade ist kein Kriegsfotograf. Dennoch steht der Krieg thematisch immer wieder im Mittelpunkt seiner freien Arbeiten.
Aufgenommen wurde dieses Bild in Beltring, wo sich jedes Jahr rund 100 000 Menschen zu einer riesigen «Living History»-Veranstaltung treffen. Sogenannte «Re-enactors» spielen an dieser «War and Peace Show» Szenen der grossen Kriege nach – mit der Begründung, dass sie Geschichte für andere erfahrbar machten und damit das Bewusstsein für die Schrecken des Krieges schärften. Die klassische Kriegsfotografie bedient sich einer ähnlichen Argumentation: zeigen, um abzuschrecken. Meinrad Schade wählt eine andere Strategie.
Er beleuchtet die Nebenschauplätze, auf denen Krieg und Frieden unheilvoll ineinandergreifen und die Faszination für das Martialische unter dem Deckmantel der Aufklärung verharmlost wird. Der Protagonist des Bildes symbolisiert mit seiner aufgerichteten Panzerkanone zumindest eine lächerliche Potenz, und Schades Sarkasmus ist dabei offenkundig.
Ein Mahnmal

Werner Bischof: Opfer des Atombombenabwurfs über Hiroshima, Japan, 1951.
Ein Rücken wie ein Schlachtfeld – verwundet, versengt, vernarbt. «Einer der wenigen überlebenden Zeugen des 6. August 1945 in Hiroshima», schrieb der Schweizer Magnum-Fotograf Werner Bischof (1916–1954) zu seiner 1951 entstandenen Fotografie. «Kaum eine Meile vom Zentrum der Explosion entfernt, versuchte er in einen Hauseingang zu entkommen und wurde von radioaktiven Strahlen verbrannt.» Nach verschiedenen Einsätzen im Koreakrieg, die ihn am Sinn seines Berufs zweifeln liessen, suchte Bischof zu dieser Zeit in Japan nach einem Ausweg aus dem schnelllebigen Fotojournalismus. Seine Bilder wurden ruhiger, meditativer, subjektiver.
Die Aufnahme des versehrten Rückens ist bezeichnend für Bischofs Wunsch nach Vertiefung, seine Abscheu gegen Fotografien, die bloss um Aufmerksamkeit schreien. Statt einer personenbezogenen Opfer-Story schuf er ein Manifest gegen den Krieg. Wie ein Mahnmal präsentiert sich der Körper – eine sorgfältig gestaltete Skulptur, aufgenommen im Streiflicht, das die Verletzungen schonungslos beleuchtet. Obschon der Mann sein Gesicht abwendet, fällt es nicht schwer, sich mit ihm zu identifizieren. Seine Narben haben den Fotografen vielleicht auch an seine eigene Verletzlichkeit erinnert.
Hinausschauen – hineinschauen

Robert Frank: Landsgemeinde, Hundwil, 1949.
Robert Frank, 1924 in Zürich geboren, ist einer der einflussreichsten Fotografen des 20. Jahrhunderts. Sein 1958 erstmals publiziertes Buch «Les Américains», ein kritisches Porträt der USA, hat Generationen von Fotografinnen und Fotografen die Augen geöffnet – nicht zuletzt durch den rohen, spontanen und radikal subjektiven Stil, mit dem er die Fotografie der Nachkriegszeit revolutionierte.
Nach seinem Tod am vergangenen Montag hat die Weltpresse seine Amerika-Bilder einmal mehr als Ikonen gewürdigt. Dabei hat Frank seinen Stil nicht erst auf dem Roadtrip durch die Vereinigten Staaten erfunden. Schon 1949, anlässlich einer Landsgemeinde in Hundwil, nahm er etwa vorweg, was später zum Signum seines Amerika-Buches werden sollte: Der Blick auf das Unscheinbare, schnappschussartige Unschärfe oder angeschnittene Gesichter können durchaus dazu beitragen, «etwas Wahres» zu sagen.
«Ich mache immer wieder dieselben Bilder. Ich versuche immer, im Draussen das Drinnen zu sehen. Ich versuche etwas zu sagen, das wahr ist. Aber vielleicht ist nichts wirklich wahr. Ausser dem, was dort draussen ist – und was dort draussen ist, verändert sich laufend.» Hinausschauen – hineinschauen: Gäbe es ein besseres Beispiel für Franks fotografische Dialektik als die Hundwiler Wirtshausszene?
Moderne Frauen

Marianne Breslauer: Paris, 1937.
Marianne Breslauer (1909–2001) beginnt 1927 ihre Ausbildung zur Fotografin am Berliner Lette-Verein. Sie bewegt sich in Künstlerkreisen und hält den Zeitgeist der Weimarer Republik in ausdrucksstarken Porträts fest. Während eines Aufenthalts in Paris entdeckt die junge Fotografin eine neue Bildsprache für sich: Sie flaniert durch die Strassen, beobachtet diskret und lässt sich von der urbanen Kulisse auch einmal zu behutsamen Arrangements inspirieren.
Die Aufnahme der Zigarettenraucherin vor der Wand mit dem Schriftzug «Défense d’Afficher» ist gestellt: Neben der eleganten Protagonistin wirkt jede Art von Verbot kleinlich; der Schatten der Laterne und der geisterhafte Graffiti-Kopf tragen dazu bei, dass die Szene einem Film noir entnommen scheint. Hier posiert Ilse Jutta Zambona, die erste Ehefrau von Erich Maria Remarque. Mit dem Schriftsteller bleiben Marianne und ihr Mann, der Kunsthändler Walter Feilchenfeldt, auch nach ihrer Flucht aus Nazideutschland verbunden. Kontakte in die Schweiz pflegte die Fotografin, schon bevor sie sich 1948 in Zürich niederliess: Von Arnold Kübler übernahm sie Aufträge für die «Zürcher Illustrierte», und mit Annemarie Schwarzenbach reiste sie 1933 nach Spanien. Obwohl viele ihrer Arbeiten in Magazinen abgedruckt wurden, legte Marianne Feilchenfeldt die Kamera noch nicht 30-jährig zur Seite und machte sich einen Namen als Kunsthändlerin.
Was bleibt

Virginie Rebetez: Aus der Serie «Packing», 2012.
Kleidungsstücke – gefaltet und sorgfältig ausgeleuchtet liegen sie da und ruhen in sich selber.Vordergründig stehen die Socken und Hosen im Mittelpunkt.Weiss man aber, dass die Kleider von Verstorbenen zum Zeitpunkt ihres Todes getragen wurden, versucht man sich sogleich die Trägerinnen und Träger vorzustellen, deren Abwesenheit offenbar wird. Gepackt wurden diese Hüllen von einem Bestattungsinstitut für die Angehörigen, die sie nie abgeholt haben. Die 1979 in Lausanne geborene Fotografin Virginie Rebetez nennt ihre 12-teilige Serie «Packing» – und spielt damit wohl auch auf «die letzte Reise» an, als könnte man dafür noch ein paar nützliche Sachen einpacken.
Die Themen Absenz, Verlust, Identität und Tod sind zentral im Werk von Rebetez,die sich auch schon beim Pflanzengiessen, Essen und Fernsehen in der Wohnung kürzlich Verstorbener ablichtete. Damit nimmt sie den Faden des alltäglichen Lebens, der durch den Tod plötzlich gerissen ist, für einen Moment wieder auf.Andere Serien sind eine fotografische Spurensuche im Fall einer verschwundenen Frau oder von nicht identifizierten Mordopfern. Gemeinsam ist allen Fotografien, dass Virginie Rebetez den Menschen sehr nahe kommt, ohne sie direkt abzubilden. Sie hält nur fest, was von ihnen in der Welt zurückbleibt. So wirken ihre Bilder dem Verschwinden entgegen.
Frohe Botschaft

Leonard von Matt: Vinzentinerinnen, Vatikan, 1958.
Entzückung, Aufregung, Freude – das spricht aus den Gesten der Nonnen. Ihre Blicke richten sich auf den Kardinal in der Limousine, der soeben die Sixtinische Kapelle verlassen hat. Leonard von Matt hat den euphorischen Moment festgehalten, als 1958 das Konklave beendet wurde: Johannes XXIII. wurde zum 261. Papst gewählt. Der fotografische Autodidakt, aus einer Stanser Buchhändler-Familie stammend, hatte in seinen frühen Jahren den Alltag in der Innerschweiz dokumentiert. Eine Rom-Reise 1946 bildete den Auftakt zu einer fotografischen Bestandesaufnahme von Kulturgütern in Italien, Frankreich, Spanien und Griechenland.
Dank seinen guten Beziehungen erhielt er Zutritt zu Bereichen im Vatikan, wo sich sonst nur Kleriker und Ordensleute aufhielten. Sein besonderes Verdienst bestand in einer Reihe von Bildbänden über den Vatikan – dafür wurde er 1951 in den Ritterstand des Gregorius-Ordens erhoben. Von Matts Fotografien vermitteln einzigartige Einsichten während des Konklaves: die Umbauten in der Sixtinischen Kapelle für die Papstwahl, die versiegelte Türen, die improvisierten Schlafgemächer für die Kardinäle. In der Aufnahme der Vinzentinerinnen kontrastieren zwei Welten, die fast schwebenden, weissgewandeten Nonnen und das elegante, schwarz glänzende Auto aus der obersten Etage des Klerus.
Pilger auf dem Eis

Otto Pfenniger: Skitourenfahrer auf einem Gletscher, um 1950.
Otto Pfenniger (1919–2004) war kein verwegener Fotoreporter, sondern ein sorgfältiger Handwerker und einfühlsamer Beobachter des Alltäglichen. Bevor er sich 1959 selbständig machte und ein Geschäft in Zürich eröffnete, hatte er Erfahrungen in verschiedenen Fotostudios gesammelt, unter anderem als Laborchef des renommierten Basler Ateliers Eidenbenz. Photoglob-Wehrli, einer auf Postkarten spezialisierten Tochterfirma der Orell Füssli AG, lieferte Pfenniger zahlreicheAnsichten von Schweizer Landschaften. Insbesondere mit der alpinen Welt setzte sich der passionierte Bergsteiger auch fotografisch auseinander. Dabei verfolgte erstets den Anspruch, sich durch unkonventionelle Bildkompositionen vom Durchschnitt abzuheben. Er beherrschte das Spiel mit dem Gegenlicht und experimentierte, wie in diesem Beispiel, mit ungewöhnlichen Perspektiven: En miniature und am Bildrand verloren bewegen sich die Schattenrisse der Skitourenfahrer über eine Ebene, die in die Vertikale zu kippen scheint. Kein Horizont, der dem Auge Halt bietet, kein Gipfel, der ein Ziel erkennen lässt – in dieser Eiswüste wirkt die kleine Karawane wie ein Pilgerzug; man ist versucht, die schwer zu verortende Szene als Sinnbild zu lesen. Die fein strukturierte, stellenweise aufbrechende Oberfläche des Gletschers wiederum erinnert aus heutiger Sicht an die geschundene Haut eines gigantischen, urtümlichen Wesens
Insekten in Sicht

Kurt Caviezel: Insect 14, 2009.
Die Augen des NetcamFotografen Kurt Caviezel sind (fast) überall. Rund 20 000 Kameras, über den ganzen Globus verteilt, liefern ihm Aufnahmen in Echtzeit auf seinen Bildschirm. Von seinem Atelier in Zürich aus geht er per Mausklick auf Reisen und fischt flüchtige Momente aus dem Bilderstrom, den die von ihm angesteuerten privaten und öffentlichen Kameras ins Netz einspeisen. Doch der 1964 in Chur geborene Künstler tut dies nicht, um Informationen zu sammeln oder andere Menschen zu überwachen. Vielmehr interessiert er sich für Bilder, die eigentlich von niemandem so vorgesehen waren.
Neben Bildstörungen, unbeabsichtigten Selfies oder rätselhaften Botschaften an die Cybercommunity gehören auch Motive dazu, in denen sich die Natur zurückmeldet. So etwa, wenn ein Vogel die Kamera als Landeplatz missbraucht und – statt der Skipiste – sein Gefieder vor der Linse erscheint. Oder wenn Insekten einen Apparat hoch über dem pittoresken Marktplatz einer Kleinstadt vereinnahmen, nicht ganz im Sinn der lokalen Tourismusorganisation. Kurt Caviezel besitzt heute ein Archiv von rund vier Millionen NetcamBildern: ein unerschöpfliches Reservoir fürseine künstlerische Arbeit, mit der er ein skurriles, fremdvertrautes Kaleidoskop unserer Zeit entwirft.
Hodlers letzter Tag

Gertrud Dübi-Müller: Ferdinand Hodler mit Ehefrau Berthe und Tochter Paulette, «Port Noir», Genf, 18. Mai 1918.
Ferdinand Hodler gehört zu den meistfotografierten Schweizer Künstlern seiner Zeit. Es gefiel ihm, sich selbst in Szene zu setzen – am liebsten vor der Kamera von Gertrud Dübi-Müller (1888–1980). Die junge Solothurnerin, die als bedeutende Kunstsammlerin in die Geschichte eingehen sollte, war ihm nicht nur Modell, sondern auch eine geliebte Freundin. Von 1911 bis 1918 lichtete sie ihn über 100 Mal ab. In einer Epoche, in der das repräsentative Porträt noch zur Domäne der professionellen Studiofotografie gehörte, machte die Autodidaktin spontane Momentaufnahmen, vor allem im Freien.
Immer wieder verstand sie es, Hodler zu kleinen Auftritten und Spässen zu animieren. Die Unmittelbarkeit und Frische ihrer Bilder mutet modern an: Mit Gertrud Müller – damals noch unverheiratet – zeigte sich der berühmte Maler auch einmal von seiner unprätentiösen und verletzlichen Seite, übermütig oder gedankenverloren. Am 18. Mai 1918 begleitete Gertrud ihren Freund bei einem Spaziergang am Genfersee, gemeinsam mit seiner Frau Berthe und seiner Tochter Paulette. Berthe schaut in die Ferne, das Kind ist mit sich selbst beschäftigt. Nur der Künstler, eine unsichtbare Last im Nacken, blickt fragend in die Kamera. Was er wohl sieht? Am folgenden Tag ist Hodler tot.
Verzauberter Abstellplatz

Emil Schulthess: Auto-Occasionsmarkt an der Livernois Avenue, Detroit, 1953.
Nachdem sich Emil Schulthess (1913–1996) in den 1930er Jahren vor allem als Grafiker einen Namen gemacht hatte, trat der gebürtige Zürcher in der Nachkriegszeit vermehrt als Fotograf und Gestalter von monumentalen Bildbänden in Erscheinung. Die Erkundung ferner Kontinente und der Drang, die Wunder der Natur in einprägsamen Bildern darzustellen, ziehen sich durch sein ganzes Werk. Erste ausgedehnte Reisen führten Schulthess in den 1950er Jahren nach Afrika und in die USA, später folgten Ziele in Asien und Südamerika sowie die Teilnahme an einer Expedition der US Navy in die Antarktis.
Seine Fotobücher über die bereisten Gebiete wurden zu internationalen Bestsellern. Darüber hinaus war Schulthess ein Pionier der Farbfotografie, der keinen Aufwand scheute, um qualitativ hochstehende Farbaufnahmen drucktechnisch perfekt umzusetzen. Diese Fotografie eines Auto-Occasionsmarktes in Detroit, die 1953 während seiner USA-Reise entstand, vermittelt eine geradezu feierliche Stimmung: Die Lichterketten spiegeln sich in den polierten Karosserien und verzaubern die Gebrauchtwagen – die meisten nicht älter als fünf Jahre. Das Bild steht für eine Nation des schnellen Konsums und für eine Zeit, in der sich breite Bevölkerungsschichten zum ersten Mal den Traum der grenzenlosen Mobilität erfüllen konnten.
Schwerelos schwebend

Monique Jacot: Maternité de Morges, 1980.
Monique Jacot, 1934 in Neuenburg geboren, hat sich immer wieder mit weiblichen Lebenswelten auseinandergesetzt. Ihr persönliches Interesse und Gespür für feministische Perspektiven half ihr wohl dabei, sich im männlich dominierten Fotojournalismus zu behaupten. In den 1980er und 1990er Jahren dokumentierte sie den Alltag von Bäuerinnen sowie Fabrikarbeiterinnen und begleitete die Frauendemonstrationen aus Anlass der Wahlniederlage von Christiane Brunner. Wenn sie von den Redaktionen damit beauftragt wurde, «Frauenthemen» zu fotografieren, nahm sie dies aber auch als die Herausforderung an, etwas anderes abzuliefern als gewöhnliche Reportagebilder.
So etwa, als die Zeitschrift «L’Illustré» Bilder zu einem Bericht über neue geburtsvorbereitende Angebote im Spital von Morges bestellte: Die Badenden sind auf den ersten Blick kaum als Schwangere zu identifizieren, und die Schwimmbretter bleiben ebenfalls verborgen. Der Rand des Bassins und die Spiegelung der Fensterfront deuten die Umgebung des Hallenbades nur an. Herausgelöst aus ihrem Kontext verwandeln sich die Körper in scheinbar schwerelos schwebende Figuren eines schwarz-weissen Ornaments. Diese Wendung ins Melancholisch-Poetische ist typisch für die Fotografin, die ihren subjektiven Stil stets auch in ihre Auftragsarbeiten einbrachte und damit immer wieder Bilder schuf,welche die Tagesaktualität überdauern.
Streifzüge durch New York

Nicolas Faure: Zwei Badenixen am Pier des Hudson River in New York, 1980.
Nicolas Faure, geboren 1949, wurde mit unkonventionellen Schweiz-Bildern bekannt: Seine grossformatigen Aufnahmen von Autobahnlandschaften zum Beispiel brachen radikal mit der Tradition der idyllisierenden Kalenderfotografie, welche die Darstellung der Schweiz so lange geprägt hatte. Weniger bekannt ist, dass sich der aus Genf stammende Autodidakt schon in den späten 1970er Jahren ganz der Farbe verschrieben hatte – zu einer Zeit, in der die Schwarz-Weiss-Fotografie immer noch als künstlerisch wertvoller galt. Damals lebte Faure in New York und entwickelte auf seinen Streifzügen durch die Stadt eine eigene fotografische Handschrift.
Sein Interesse galt dem urbanen Alltag, in dem skurrile Gegensätze aufeinandertreffen. Die erotisch aufgeladene Inszenierung der zwei Badenixen auf dem heruntergekommenen Pier am Hudson River vereint Glamour und Schäbigkeit. Als Beobachter dieses Fotoshootings thematisiert Nicolas Faure zugleich auch Exhibitionismus und Voyeurismus als Grundzüge des Mediums Fotografie. Für seine anekdotische und lebensnahe Street-Photography war die Farbe ein unabdingbares Stilmittel. Eine Auswahl seiner Aufnahmen veröffentlichte er später im Buch «Goodbye Manhattan» – ein spannendes Zeugnis des Kulturwandels, der die Fotowelt erst im darauffolgenden Jahrzehnt so richtig erfassen und die Farbfotografie museumstauglich machen sollte.

