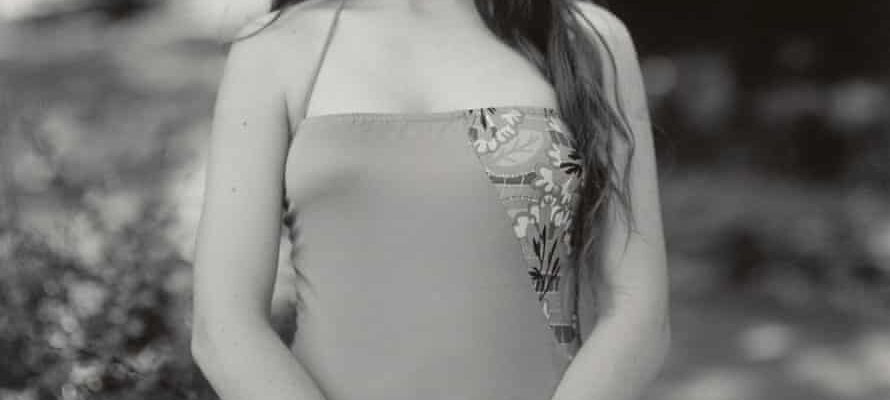Back im Jahr 1967, als Judith Joy Ross eine schüchterne und unbeholfene 20-Jährige war, die noch herausfand, wie man Fotografin wird, machte sie sogenannte „heimliche Bilder“ von Menschen auf der Straße. „Ich hatte verschiedene kleine Techniken“, erzählt sie mir. „Oft tat ich so, als würde ich trainieren, wie man die Kamera bedient, während ich tatsächlich fotografierte.“
Wie, frage ich, hat sie ihr Selbstbewusstsein überwunden und sich den unzähligen vorbeigehenden Fremden genähert, deren Porträts heute zu den einzigartigsten und berührendsten Werken der amerikanischen Fotografie zählen? „Du suchst dir ein Thema aus und zwingst dich dazu“, antwortet sie. „Das war hart für mich. Es war wie, wie viel Folter kann ich ertragen? Aber was ich in einer Person sehen würde, wenn auch nur für einen Moment, war so wunderbar, es war es wert.“
Ein Gespräch mit Ross, die jetzt Mitte 70 ist, ist eine unberechenbare Fahrt. Sie ist weise, unglaublich lustig und offen – über sich selbst und andere. Oh, und sie schwört. Viel.
„Als Fotograf sollte man nicht an seinen Motiven hängen“, sagt sie an einer Stelle, „aber ich schon damit verdammt befestigt. Ich hänge sogar an Dingen, die andere für Müll halten. Im Grunde liebe ich einfach Dinge, die ich schon lange kenne.“
In einem neuen retrospektiven Buch Judith Joy Ross: Fotografien 1978-2015, die Dinge, die sie liebt – Bäume, Räume, Fenster, alle in betörender Schönheit – sind den gewöhnlichen Menschen, die sie getroffen hat, zahlenmäßig unterlegen und haben sie in ihren geschickt komponierten, ruhig aufschlussreichen Porträts irgendwie außergewöhnlich gemacht. Neben einer Retrospektive ihrer Arbeiten, die gerade eröffnet wurde LeBal in Parismacht das Buch deutlich, was viele ihrer Fotografenkollegen seit Jahren sagen: dass Judith Joy Ross Amerikas größte lebende Porträtistin sein könnte.
Der amerikanische Dokumentarfotograf Gregory Halpern hat sie kürzlich angerufen „der größte Porträtfotograf, der jemals in diesem Medium gearbeitet hat“. Alys Tomlinson, eine gefeierte junge britische Fotografin, die sie als Einfluss anerkennt, sagt: „Ich verstehe nicht, warum sie nicht bekannter ist. Vielleicht liegt es daran, dass sie sich zu Menschen hingezogen fühlt, an denen man vielleicht auf der Straße vorbeigeht und es nicht bemerkt. Sie erhöht sie mit ihrer Kamera. Ihre Porträts sind nicht neutral. Es gibt eine Empathie auf ihrer Seite. Eine tiefe Verbundenheit. Sie lässt dich ihre Motive genau betrachten und über sie nachdenken.“ Interessanterweise erzählt mir Ross, dass sie selten reiche Menschen und „nur manchmal“ arme Menschen fotografiert. „Ich suche“, sagt sie, „nach Leuten wie mir.“
Die meiste Zeit ihres Arbeitslebens hat Ross eine auf einem Stativ montierte 20 x 25 cm große Plattenkamera verwendet, die, wie sie sagt, „so groß und verdammt schön ist, dass sie die Leute entwaffnet. Es ist, als wäre der Zirkus in die Stadt gekommen! Sie fühlen sich besonders an – jedenfalls meistens.“ Ihre Porträts strahlen oft eine fast leuchtende Ruhe aus, deren Präsenz durch die verschwommenen Schatten und undeutlichen Formen im Hintergrund noch verstärkt wird. Es ist, als ob alles Fremde in dem Moment wegfällt, in dem sie auf den Auslöser drückt. Als ich vorschlage, dass sie einen charakteristischen Stil hat, den viele anstreben, aber nur wenige erreichen, sagt sie nur halb im Scherz: „Alle meine Bilder sehen auf jeden Fall gleich aus, was mir irgendwie unheimlich ist. Ich suchte jedoch keinen Stil. Die Welt kann nicht definiert werden.“
Ross wuchs in Hazleton auf, einer kleinen Bergbaustadt in Pennsylvania, wo ihr Vater einen Fünf-und-Cent-Laden hatte und ihre Mutter Klavier unterrichtete. Für eine frühe Serie, Eurana Park (1982), besuchte sie erneut ein Freibad im nahe gelegenen Weatherly, das sie als Kind besuchte. Die Porträts erinnern auf brillante Weise an die Trägheit dieser langen Sommer sowie an die Ungeschicklichkeit der Jugend. In einem steht ein kleiner Junge mit einem Puddingschüssel-Haarschnitt und hält steif einen Gartenrechen. In einem anderen starrt ein junges Mädchen in die Linse, ihr Blick ist so entschlossen, dass es eine Weile dauert, bis sie bemerkt, dass ihr Haar nass und platt vom Schwimmen ist und ihre Stirn immer noch mit winzigen Wassertropfen gesprenkelt ist. Die Details sprechen Bände über Ross’ konzentrierten Blick. „Fotografieren ist für mich taktil“, sagt sie. „Es ist sinnlich. Ich finde die Schönheit, die in den gewöhnlichen Umständen des Alltäglichen liegt. Ich transformiere diese Gewöhnlichkeit jedoch nicht. Ich nehme es auf.“

Die Porträts im Eurana Park entstanden im Schatten des Todes ihres Vaters. „Es war eine sehr schwierige Zeit“, sagt sie. „Als Kind gingen wir an besonderen Tagen dorthin und es war wie Brigadoon für mich. Spielende Kinder, Frösche, riesige Schierlingsbäume. Als ich dorthin zurückkehrte, um zu fotografieren, trauerte ich um meinen Vater. Er ist irgendwie bei der Arbeit.“
Man spürt, dass ihre Teenagerjahre nicht ganz glücklich waren. Sie hebt ein Bild hervor: ein Gruppenporträt, auf dem drei Mädchen ein junges Paar betrachten, das auf einem nahegelegenen Auto sitzt. „Das Mädchen, das an ihren Fingernägeln kaut, das war ich“, sagt sie mir sachlich. „Der soziale Verlierertyp, der beobachten darf, nicht sein.“ Als ich sie frage, ob sie als Teenager auf der Flucht war, sagt sie: „Ich bin immer noch auf der Flucht. Damals hätte ich gesagt, ich sei am Arsch. Für die meisten Menschen ist Sexualität eine coole Sache, aber nicht für mich.“
Ihr Anderssein hatte sich Ende der 1960er Jahre intensiviert, als sie am Institute of Design in Chicago einen Fotografiekurs belegte. Ihr Lehrer war der Fotograf Aaron Siskind, ein Bilderstürmer, der formale Experimente und Abstraktion über intuitives Können und Handwerk stellte. „Ich war an der Graduiertenschule eine ziemlich verlorene Person“, sagt sie, „es hat gestunken! Siskind würde 30 Fuß entfernt sitzen und sich Drucke ansehen und Dinge sagen wie: “Dieser hat eine Qualität.” Ich wusste nicht, was zum Teufel das bedeutet.“ Sie verbrachte die meisten Nachmittage im örtlichen Kino in der Innenstadt. „Ich war kein gesunder Mensch“, sagt sie. „Ich habe meinen Abschluss gemacht, weil sie mich kein weiteres Jahr hätten behandeln können.“
1983, immer noch in Trauer um ihren Vater, reiste sie nach Washington und begann mit der Arbeit an ihrer berühmtesten Serie, Portraits at the Vietnam Veterans Memorial. Fast 40 Jahre später bleibt seine stille Beobachtungsresonanz ungetrübt, jedes Porträt ein scharfer Blick auf private Kontemplation. Die Wand selbst, die mit den Namen der amerikanischen Toten beschriftet ist, ist durchgehend von einer fast unterschwelligen Präsenz. Stattdessen sind es die Gesichter, die das Gewicht der privaten Gedanken jedes Einzelnen und damit die unauslöschliche Trauer einer gespaltenen Nation vermitteln.

„Es war alles Motivation“, sagt sie heute über den Impuls, der sie dorthin geführt hat. „Der Krieg lief jeden Morgen im Fernsehen, wenn du deine Cheerios und Milch gegessen hast. Es war ärgerlich und ist es immer noch. Ich war jung und dachte, ich würde den Krieg mit meinen Fotos beenden, so unpassend es auch war, mit einem Sucher zum Vietnam-Mahnmal zu gehen und Leute zu fragen, ob ich sie fotografieren darf. Ich hatte auch diese verrückte Idee, durch meine Bilder eine Totenmesse zu machen. Ich meine, was zum Teufel war das? Ich hatte keine Ahnung von Musik.“
Als der einflussreiche amerikanische Kurator John Szarkowski die Porträts sah, wählte er 16 davon aus, um sie 1985 in einer Ausstellung mit dem Titel New Photography im Museum of Modern Art in New York zu zeigen. Nachdem er ein Guggenheim-Stipendium erhalten hatte, hatte Ross bereits damit begonnen , im Rückblick, ist ihr am wenigsten charakteristisches Werk Portraits of the United States Congress. Dies waren alles andere als gewöhnliche Menschen, und sie sagte später, dass sie sich „immer wieder eingeschüchtert“ fühlte, als sie sie in ihrer Arbeitsumgebung im Kapitol fotografierte. Die Ergebnisse sind überraschend intim, die Ausdrücke reichen von stoisch bis verletzlich. „Ich liebe es, wie die Realität in den gewöhnlichsten Begriffen aussieht“, sagt sie, „selbst im Kongress gibt es alberne Dinge.“
Das neue Buch ist ein Katalog gehobener Gewöhnlichkeit, seien es die eindringlich mysteriösen Innenräume des Sommerhauses ihrer Familie in Rockport oder die besorgten Gesichter von Menschen, die eine Woche nach dem 11. September von einem Aussichtspunkt in Eagle Rock, New Jersey, auf die veränderte Skyline von Manhattan starren .
Ihr Haus in der Nähe von Bethlehem, Pennsylvania, hat im Keller eine Dunkelkammer, in der sie ihre Abzüge akribisch entwickelt, die immer ungefähr die gleiche Größe wie ihre 8 x 10 Zoll großen Negative haben. Sie vermeidet die Strenge von Schwarz und Weiß, indem sie ihre Drucke in Goldchlorid tont, ein sorgfältiges Verfahren, das ihnen je nach Motiv einen grauen oder braunen Aspekt verleiht.
„Das habe ich mit den Eurana-Park-Bildern angefangen“, erklärt sie. „Einige, wie die drei kleinen Mädchen mit Eis am Stiel, sind braun bedruckt, weil sie voller Freude sind. Andere, hauptsächlich ältere Kinder, sind grau gedruckt, weil ich spüren konnte, dass sie bereits die grundlegenden existenziellen Probleme hatten, die Erwachsene haben. Diese Serie hat das Bewusstsein, dass das Leben hart sein wird. Zeitraum. Für mich ist das Grau unsere Sterblichkeit. Damals hätte ich das nicht gesagt, aber gestern habe ich es mir gesagt, als ich über die Bilder nachgedacht habe.“
Gegenwärtig leidet Ross nach einer Operation vor der Pandemie an einem Augenproblem, das sie mit Doppelbildern zurückgelassen hat. „Ich kann fotografieren“, sagt sie, „aber es ist schwer, spazieren zu gehen.“
Man spürt, dass die Fotografie ihr einen Weg gab, in der Welt zu sein. „Ich interessiere mich einfach für Menschen, aber ich will ihnen nicht zu nahe kommen“, sagt sie. „Ich halte sie mit der Kamera auf Distanz. Es ist wie ein magischer Zauber. Es ist ein so intensives Vergnügen, Fremde zu fotografieren, weil man sie in diesem Moment auf so intime Weise sehen kann. Es ist irgendwie verrückt, aber ich liebe einige dieser Leute, obwohl ich sie nie wieder gesehen habe.“